- Affärsnyheter
- Alternativ hälsa
- Amerikansk fotboll
- Andlighet
- Animering och manga
- Astronomi
- Barn och familj
- Basket
- Berättelser för barn
- Böcker
- Brottning
- Buddhism
- Dagliga nyheter
- Dans och teater
- Design
- Djur
- Dokumentär
- Drama
- Efterprogram
- Entreprenörskap
- Fantasysporter
- Filmhistoria
- Filmintervjuer
- Filmrecensioner
- Filosofi
- Flyg
- Föräldraskap
- Fordon
- Fotboll
- Fritid
- Fysik
- Geovetenskap
- Golf
- Hälsa och motion
- Hantverk
- Hinduism
- Historia
- Hobbies
- Hockey
- Hus och trädgård
- Ideell
- Improvisering
- Investering
- Islam
- Judendom
- Karriär
- Kemi
- Komedi
- Komedifiktion
- Komediintervjuer
- Konst
- Kristendom
- Kurser
- Ledarskap
- Life Science
- Löpning
- Marknadsföring
- Mat
- Matematik
- Medicin
- Mental hälsa
- Mode och skönhet
- Motion
- Musik
- Musikhistoria
- Musikintervjuer
- Musikkommentarer
- Näringslära
- Näringsliv
- Natur
- Naturvetenskap
- Nyheter
- Nyhetskommentarer
- Personliga dagböcker
- Platser och resor
- Poddar
- Politik
- Relationer
- Religion
- Religion och spiritualitet
- Rugby
- Så gör man
- Sällskapsspel
- Samhälle och kultur
- Samhällsvetenskap
- Science fiction
- Sexualitet
- Simning
- Självhjälp
- Skönlitteratur
- Spel
- Sport
- Sportnyheter
- Språkkurs
- Stat och kommun
- Ståupp
- Tekniknyheter
- Teknologi
- Tennis
- TV och film
- TV-recensioner
- Underhållningsnyheter
- Utbildning
- Utbildning för barn
- Verkliga brott
- Vetenskap
- Vildmarken
- Visuell konst
Om podden
Raumzeit ist eine Serie von Gesprächen mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Astronauten und Projektleitern über Raumfahrt. Jede Episode rückt einen Themenbereich in den Fokus und diskutiert ausführlich alle Aspekte und Details.
The podcast Raumzeit is created by Metaebene Personal Media - Tim Pritlove. The podcast and the artwork on this page are embedded on this page using the public podcast feed (RSS).
Avsnitt
RZ123 Die Erforschung des Jupitersystems
Der Jupiter und seine Monde lassen noch viele Fragen offen, die kommende Missionen klären sollen
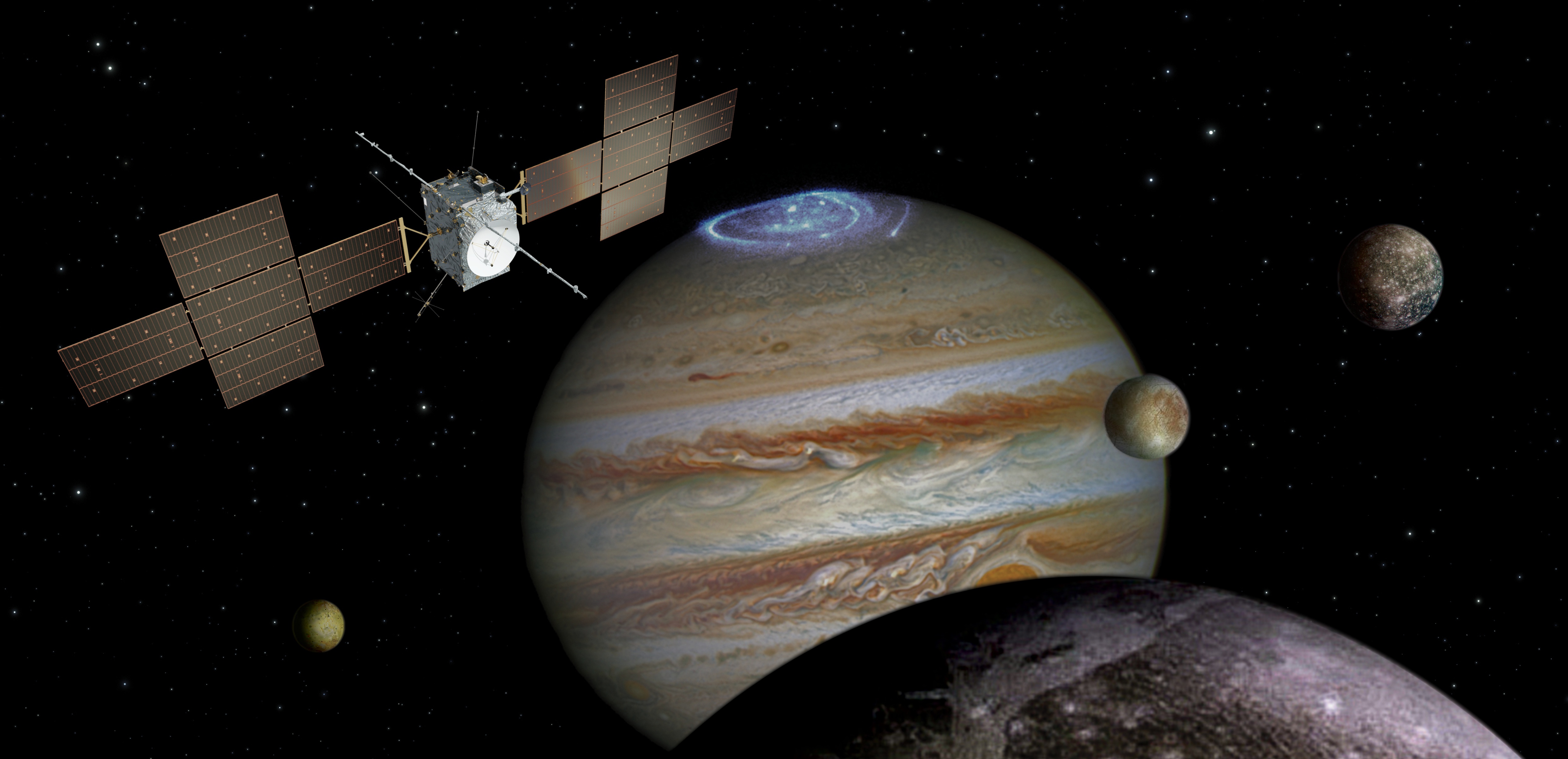
Der Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems und hat nach aktueller Zählung fast 100 Monde. Die bekanntesten davon sind die Galileischen Monde Io, Europa, Ganymede und Kallisto die, ob ihrer Größe und Unterschiedlichkeit wie auch der Jupiter selbst im Mittelpunkt der Erforschung stehen.
Dauer:
1 Stunde
53 Minuten
Aufnahme:
19.09.2024
Ich spreche mit Paul Hartough, dem Leiter Gruppe planetaren Atmosphären am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und dem Principal Investigator des Submillimetre Wave Instrument (SWI) der JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Mission.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung
Aeronomie – Wikipedia
2001: Odyssee im Weltraum – Wikipedia
Troposphäre – Wikipedia
Interstellares Medium – Wikipedia
Doppler-Effekt – Wikipedia
Albedo – Wikipedia
Pioneer (Raumsonden-Programm) – Wikipedia
Voyager-Sonden – Wikipedia
Galileo (Raumsonde) – Wikipedia
Juno (Raumsonde) – Wikipedia
Galileische Monde – Wikipedia
Enceladus (Mond) – Wikipedia
Oortsche Wolke – Wikipedia
Maxwell-Boltzmann-Verteilung – Wikipedia
Cassini-Huygens – Wikipedia
Europa Clipper – Wikipedia
CHNOPS – Wikipedia
RZ122 Cosmic Dawn
Ein Blick auf die Frühzeit nach dem Urknall, der Lichtwerdung des Universums und der Entstehung der ersten Galaxien
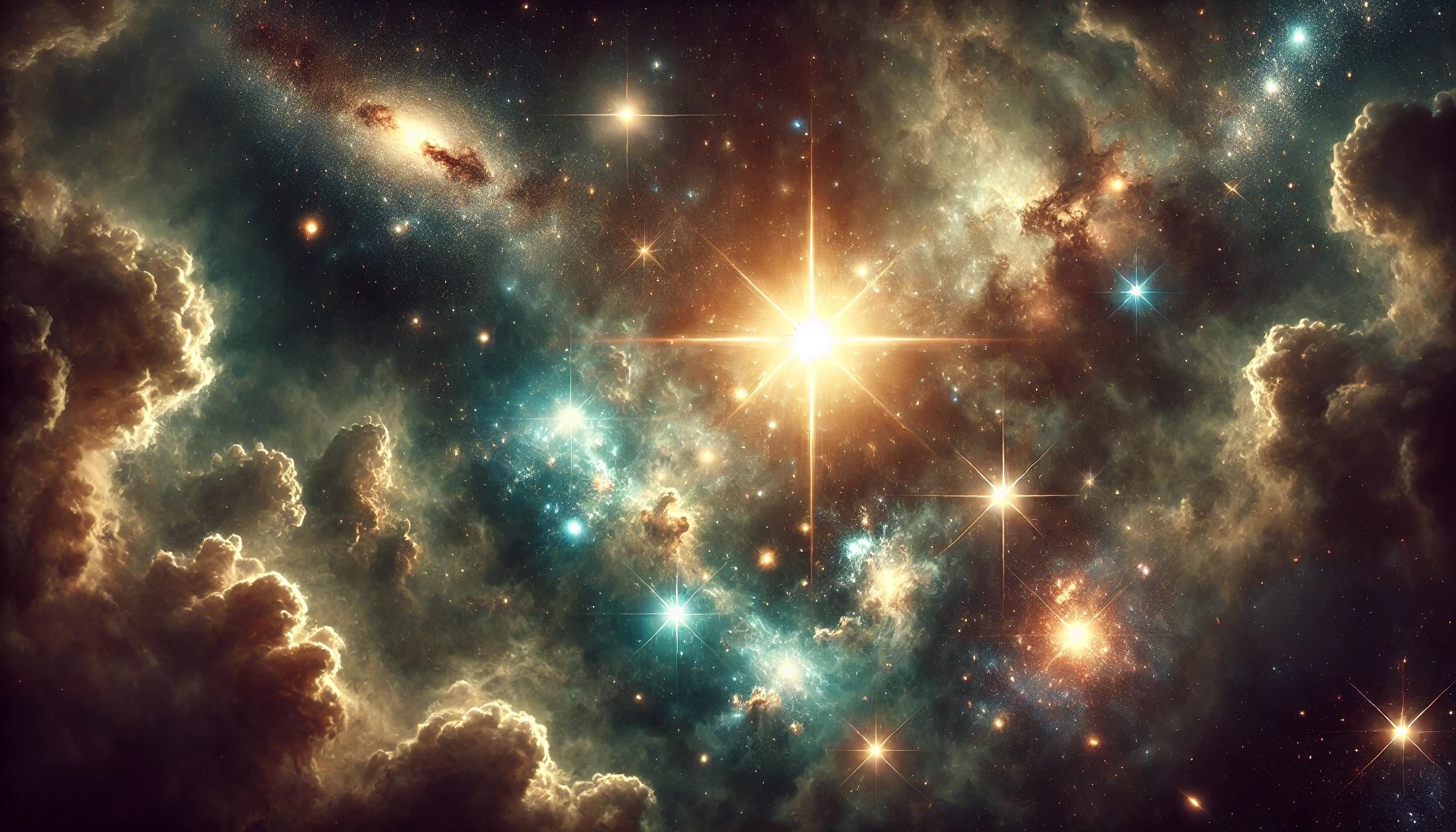
Laut der aktuellen wissenschaftlichen Sichtweise ist das Universum aus einer Singularität heraus durch eine dramatische Expansion entstanden: dem Urknall. Dabei war alle die Materie die das All heute ausmacht auf einen einzelnen Punkt konzentriert und die daraus resultierende Temperatur machte auch noch mehrere hundertausend Jahre der Ausdehnung später unmöglich, dass sich auch nur Atome bildeten, was dann aber irgendwann geschah.
Trotzdem war das Universum dann noch lange für Licht ein undurchdringbares Medium bis die ersten Sterne mit ihrer Strahlung sich langsam einen Weg bahnten bis das transparente Weltall entstand. Erste Galaxien bildeten sich und legten die Grundlage für die Ausprägung des Weltalls wie wir es heute kennen.
Dauer:
1 Stunde
53 Minuten
Aufnahme:
06.06.2024
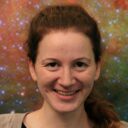
Anne Hutter |
Ich spreche mit der theoretischen Physikerin Anne Hutter vom Cosmic Dawn Center am Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen über diese Phasen der Weltwerdung, welche physikalischen Grundlagen diese Entwicklung erklären und welche wissenschaftlichen Maßnahmen unternommen werden, um dem Wesen des Urknalls und seinen Folgen auf die Spur zu kommen.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Wikipedia
Hintergrundstrahlung – Wikipedia
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam – Wikipedia
Centre for Astrophysics and Supercomputing (CAS) | Swinburne
Kapteyn Astronomical Institute | Research | University of Groningen
Niels-Bohr-Institut – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
RZ093 Das James-Webb-Weltraumteleskop | Raumzeit
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia
RZ117 Euclid | Raumzeit
Urknall – Wikipedia
Elementarteilchen – Wikipedia
Wasserstoff – Wikipedia
Helium – Wikipedia
Lithium – Wikipedia
Beryllium – Wikipedia
Cosmic Background Explorer – Wikipedia
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Wikipedia
Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia
Filament (Kosmos) – Wikipedia
Rekombination (Physik) – Wikipedia
Reionisierungsepoche – Wikipedia
Ultraviolettstrahlung – Wikipedia
Schwarzer Körper – Wikipedia
Kosmischer Staub – Wikipedia
Rotverschiebung – Wikipedia
Elektromagnetisches Spektrum – Wikipedia
Fluiddynamik – Wikipedia
Square Kilometre Array – Wikipedia
HI-Linie – Wikipedia
Lagrange-Punkte – Wikipedia
RZ121 EarthCARE
Eine neue Mission studiert auf neue Art die Zusammensetzung von Wolken und deren Auswirkungen auf das Klima
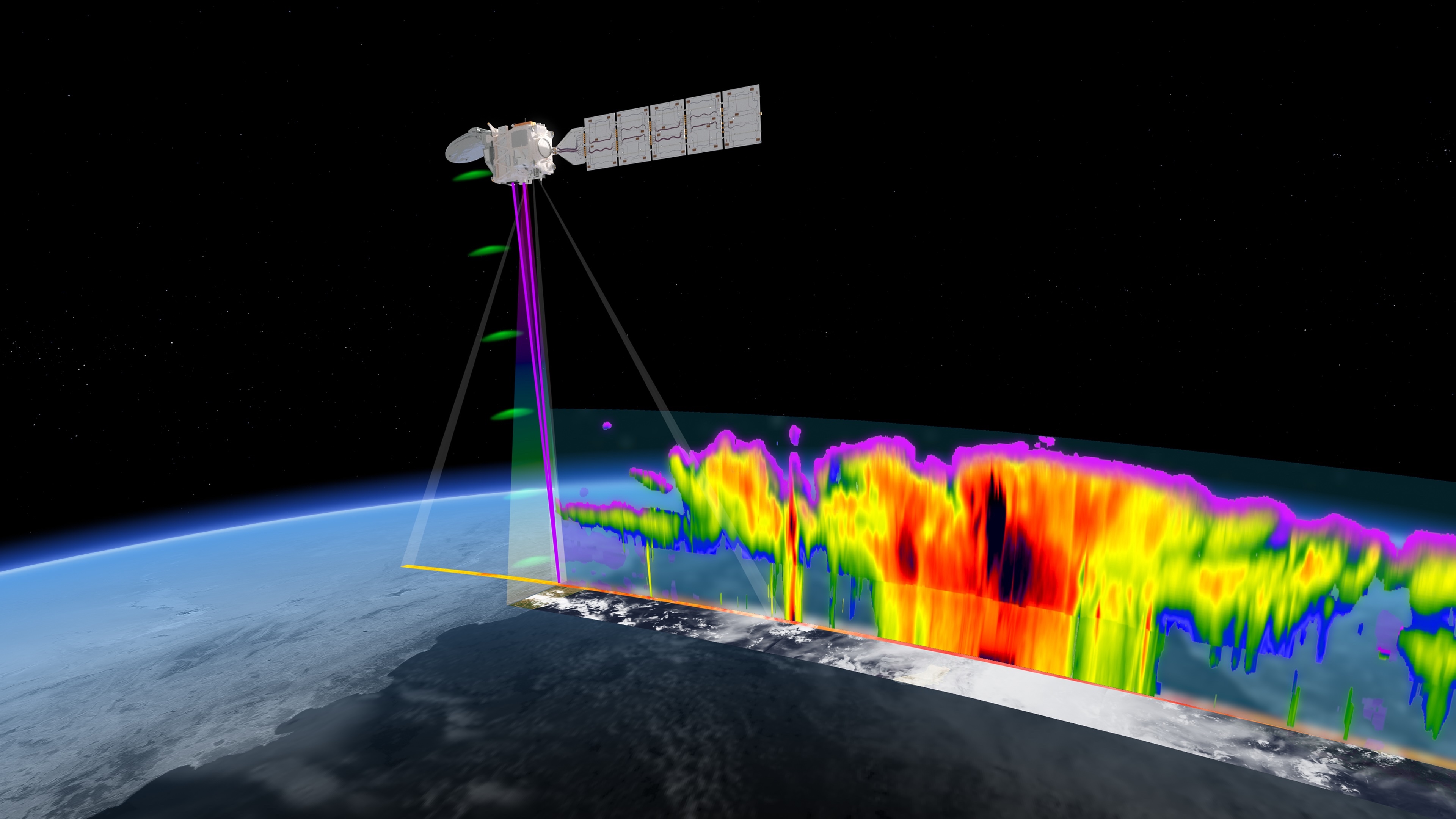
Die neue EarthCARE Mission der ESA (European Space Agency), die in Zusammenarbeit mit der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA durchgeführt wird, zielt darauf ab, unser Verständnis über die Rolle von Wolken und Aerosolen bei der Reflexion von einfallender Sonnenstrahlung zurück ins Weltall und der Speicherung von von der Erdoberfläche emittierter Infrarotstrahlung zu erweitern. Durch die Kombination von vier wissenschaftlichen Instrumenten an Bord des Satelliten, der in einer sonnensynchronen polaren Umlaufbahn die Erde umkreisen wird, sollen globale Beobachtungen von Wolken, Aerosolen und Strahlung ermöglicht werden. Diese Beobachtungen sind entscheidend, um die Wechselwirkungen zwischen Wolken, Aerosolen und Strahlung sowie deren Einfluss auf das Erdklima besser zu verstehen und zu modellieren.
Dauer:
1 Stunde
52 Minuten
Aufnahme:
19.03.2024

Björn Frommknecht |

Thorsten Fehr |
Ich spreche heute gleich mit zwei Repräsentanten der Mission. Björn Frommknecht ist Missionsleiter von EarthCare und ist vor allem für die technischen Aspekte dabei. Thorsten Fehr wiederum leitet das wissenschaftlichen Team der Mission und berichtet über die wissenschaftliche Seite des Projekts. Wir sprechen gemeinsam über die Entstehungsgeschichte der Mission, den bevorstehenden Start, das technische Design, die wissenschaftlichen Ziele und Herangehensweisen und viele andere Details.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Geodäsie – Wikipedia
Europäisches Weltraumforschungsinstitut – Wikipedia
RZ040 GOCE | Raumzeit
CERN – Wikipedia
Envisat – Wikipedia
EarthCARE – Wikipedia
Aerosol – Wikipedia
RZ013 Die Atmosphäre | Raumzeit
Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 – Wikipedia
Cirrus (Wolke) – Wikipedia
CloudSat – Wikipedia
Lidar – Wikipedia
Sojus (Rakete) – Wikipedia
Vega (Rakete) – Wikipedia
Russischer Überfall auf die Ukraine seit 2022 – Wikipedia
SpaceX – Wikipedia
Falcon 9 – Wikipedia
Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Sonnensynchrone Umlaufbahn – Wikipedia
Kamineffekt – Wikipedia
Europäisches Raumflugkontrollzentrum – Wikipedia
Spitzbergen (Inselgruppe) – Wikipedia
Troll (Forschungsstation) – Wikipedia
Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage – Wikipedia
Sentinel-2 – Wikipedia
SPOT (Satellit) – Wikipedia
Voxel – Wikipedia
Meteosat – Wikipedia
Voyager 1 – Wikipedia
ADM-Aeolus – Wikipedia
GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) – Wikipedia
EarthCARE - Earth Online
RZ120 Ulf Merbold
Ein Gespräch mit dem ehemaligen Astronauten Ulf Merbold im Zeiss-Großplanetarium Berlin
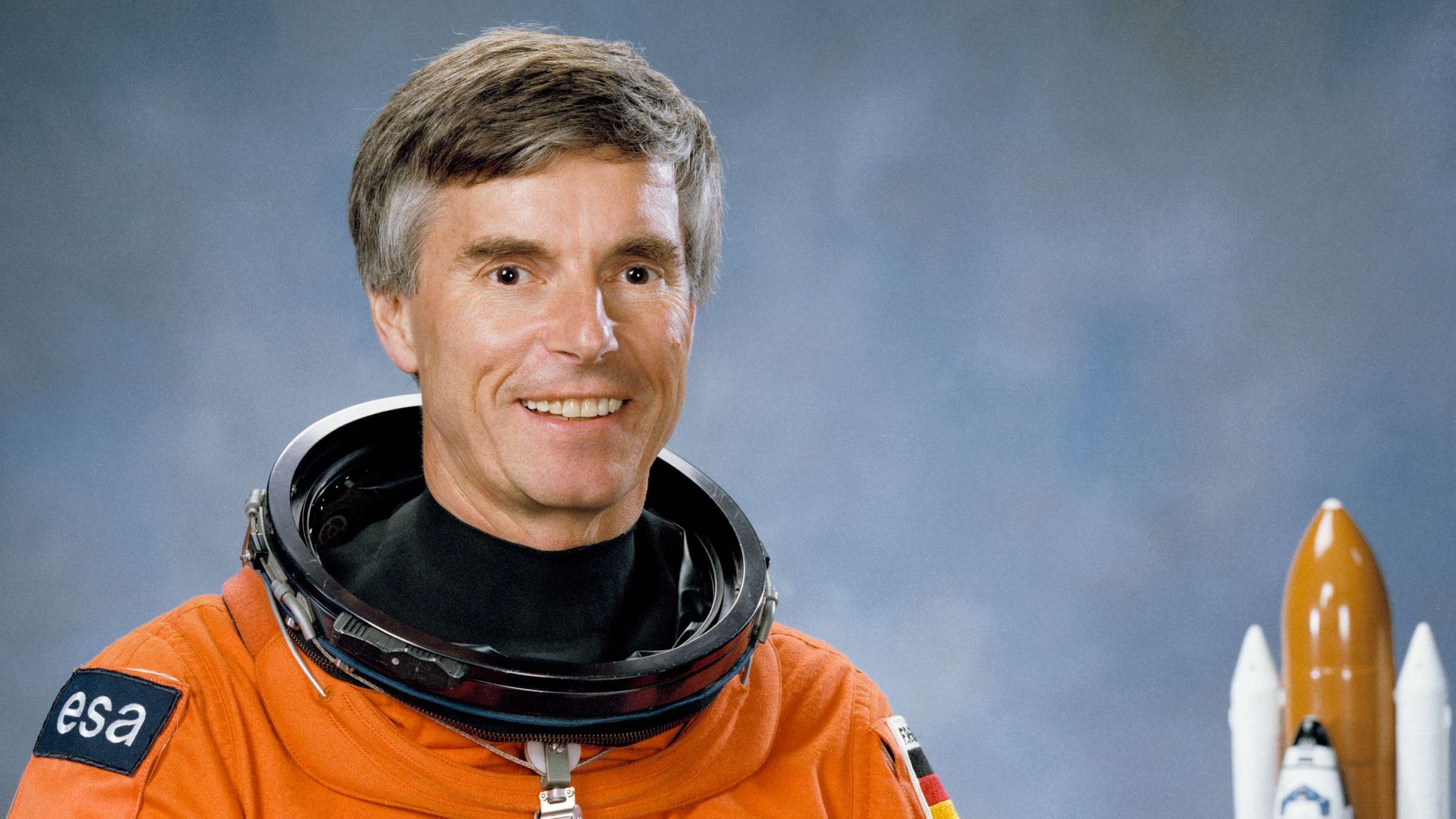
Ulf Merbold ist der erste westdeutsche im All und bis heute derjenige mit den meisten Ausflügen in den Orbit - drei an der Zahl. Er war sowohl mit den Amerikanern an Bord des Space Shuttle als auch mit den Russen auf der Raumstation Mir über der Atmosphäre. Dazu hat er lange Zeit das Europäische Astronautenzentrum in Köln geleitet und maßgeblich zur Planung des europäischen Forschungsmoduls Columbus auf der Internationalen Raumstation ISS beigetragen.
Dauer:
1 Stunde
52 Minuten
Aufnahme:
21.02.2024

Ulf Merbold |
Ulf Merbold blickt auf eine lange Karriere als Physiker, Astronaut und Organisator von Raumfahrtprogrammen zurück. Im Gespräch berichtet er von seinem Weg zur Raumfahrt, seinen drei Raumfahrt-Missionen, den Herausforderungen in der neuen Kooperation sowohl mit Amerikanern und Russen und den Belastungen und Offenbarungen, denen man als Astronaut ausgesetzt ist.
Das Gespräch fand live im Zeiss-Großplanetarium in Berlin vor Publikum statt.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Sigmund Jähn – Wikipedia
Greiz – Wikipedia
Sputnik – Wikipedia
Orion (Raumschiff) – Wikipedia
Automated Transfer Vehicle – Wikipedia
Columbus (ISS-Modul) – Wikipedia
Spacelab – Wikipedia
Kraftwerk (Band) – Wikipedia
Johann Sebastian Bach – Wikipedia
STS-9 – Wikipedia
Casablanca – Wikipedia
STS-51-L – Wikipedia
Sojus (Rakete) – Wikipedia
REM-Schlaf – Wikipedia
Northrop T-38 – Wikipedia
Hermann Oberth – Wikipedia
Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski – Wikipedia
Jules Verne – Wikipedia
Von der Erde zum Mond – Wikipedia
Douglas Adams – Wikipedia
RZ119 Das Ariane-Raketenprogramm
Ein Rückblick auf die Geschichte der Ariane-Raketen und ein Ausblick auf die Ariane 6

Nach einem rumpeligen Start mit der "Europa"-Rakete haben sich die führenden europäischen Techniknationen in den 1970er Jahren erfolgreich in dem Ariane-Raketenprogramm zusammengefunden, was dann auch schnell zur Mitgift bei der Gründung der ESA wurde. Besonders die Ariane 5 war dann lange Zeit eine der erfolgreichsten und zuverlässigsten Raketensysteme der Welt. Jetzt ist die letzte Ariane 5 gestartet und in diesem Jahr wird mit dem Jungfernflug der neuen Ariane 6 gerechnet.
Dauer:
2 Stunden
16 Minuten
Aufnahme:
19.01.2024

Denis Regenbrecht |
Ich spreche mit Denis Regenbrecht, Gruppenleiter für den Bereich Ariane in der Abteilung Operationelle Träger und Infrastruktur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Wir sprechen über den Beginn der Europäischen Zusammenarbeit, die Entwicklung der ersten Ariane-Raketen, den erfolgreichen Lauf der Ariane 5, was von der Ariane 6 zu erwarten ist und unter welchen Bedingungen auch Europa die Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen angehen wird.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Wikipedia
Ariane (Rakete) – Wikipedia
Europa (Rakete) – Wikipedia
European Launcher Development Organisation – Wikipedia
Centre national d’études spatiales – Wikipedia
Europäische Weltraumorganisation – Wikipedia
Arianespace – Wikipedia
Symphonie (Satellit) – Wikipedia
Ariane 4 – Wikipedia
Pufferüberlauf – Wikipedia
Voyager-Programm – Wikipedia
Ariane 5 – Wikipedia
Hydrazin – Wikipedia
Distickstofftetroxid – Wikipedia
Spezifischer Impuls – Wikipedia
Max Q (Raumfahrtphysik) – Wikipedia
Automated Transfer Vehicle – Wikipedia
Lagrange-Punkte – Wikipedia
Satellitenorbit – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
Herschel-Weltraumteleskop – Wikipedia
Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia
Commercial Orbital Transportation Services – Wikipedia
Ariane 6 – Wikipedia
Raumfahrtzentrum Guayana – Wikipedia
Sojus (Rakete) – Wikipedia
Vega (Rakete) – Wikipedia
RZ118 Raumfahrt-Industrie
Die Rolle der Raumfahrt-Industrie beim Bau und Betrieb von Raumfahrzeugen
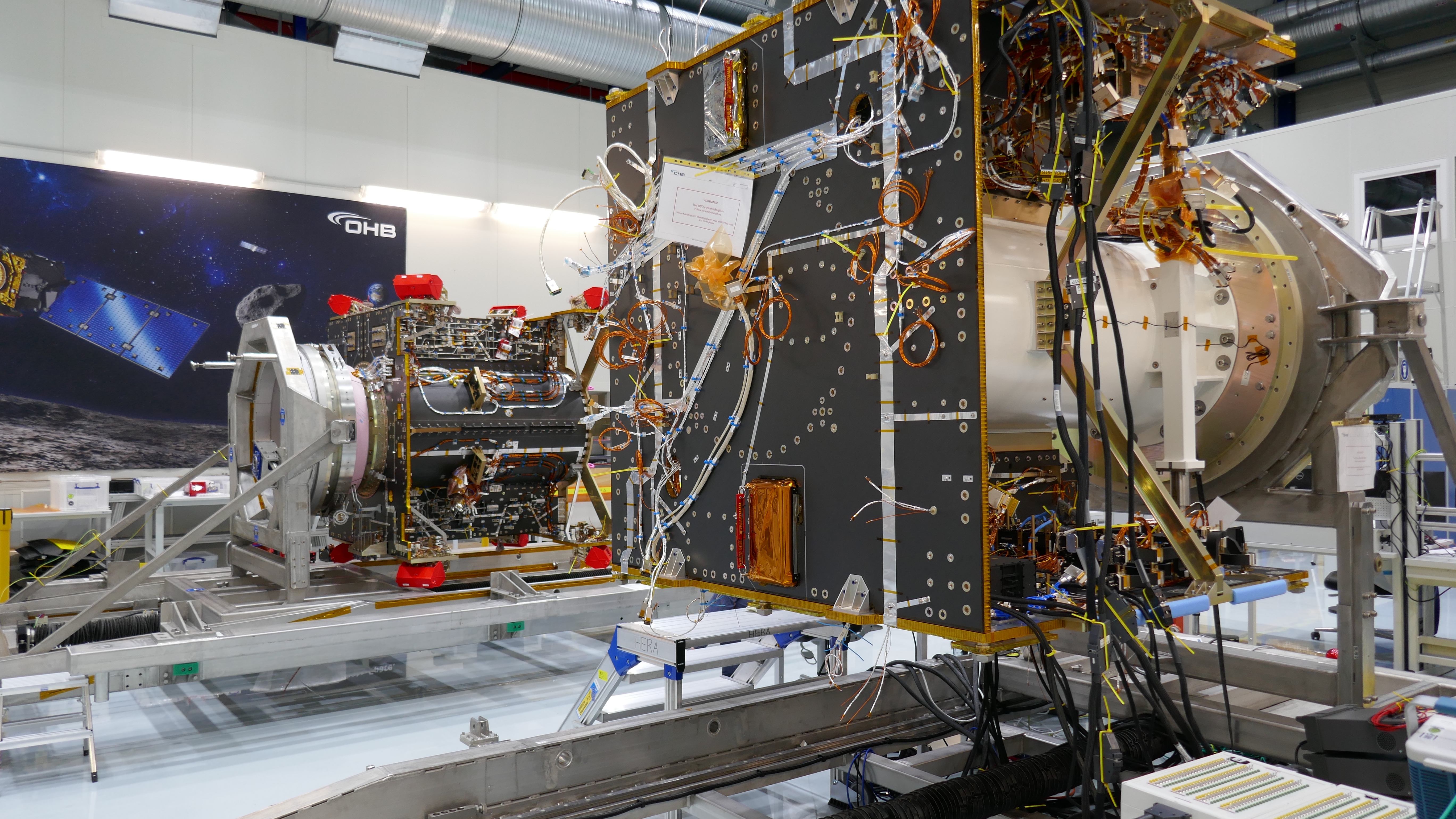
Firmen wie OHB in Bremen übernehmen in der Raumfahrt eine kritische Rolle. Als Partner der Wissenschaft und Raumfahrtagenturen begleiten sie die Planung und übernehmen den Bau der Raumfahrzeuge und Nutzlasten. Die von ihnen mit entwickelte Technik erlaubt dabei, die Satelliten immer moderner werden zu lassen und zunehmend kostengünstiger zu betreiben.
Aber nicht nur das Zustandekommen von Missionen steht im Fokus dieser Unternehmen. Immer wichtiger wird die Planung des Missionsendes, der Rückführung, Entsorgung und ggf. auch die Verlängerung von Missionen nehmen immer breiteren Raum ein. Die Problematik der Weltraumschrotts stellt die Raumfahrt vor neue Herausforderungen, die künftig mit neuen Lösungen für Planung, Reparatur oder Rettung von Missionen beantwortet werden müssen.
Dauer:
1 Stunde
57 Minuten
Aufnahme:
27.10.2023

Charlotte Bewick |
Wir sprechen mit Charlotte Bewick, Abteilungsleiterin für wissenschaftliche Missionen bei OHB in Bremen. OHB ist einer der Unternehmen, die in Europa Raumfahrzeugbau betreiben. Wir sprechen über die Aufgaben der Industrie bei der Planung von Missionen, über Fokus und Kommunikation und Organisation der eigenen Arbeit und auch über die spezielle Herausforderung der Weltraummüll-Problematik. Charlotte Bewick ist auch Gründerin des OHB-Weltraumschrott-Kompetenzzentrums und macht sich viel Gedanken darüber, wie Raumfahrt künftig technisch und rechtlich gestaltet werden muss, um die Raumfahrt auch in den nächsten Jahrzehnten noch sicher und bezahlbar zu halten.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Erdnähe – Wikipedia
Solar Orbiter – Wikipedia
PLATO – Wikipedia
Comet Interceptor – Wikipedia
Laser Interferometer Space Antenna – Wikipedia
JUICE (Raumsonde) – Wikipedia
ARIEL (Weltraumteleskop) – Wikipedia
1I/ʻOumuamua – Wikipedia
Oortsche Wolke – Wikipedia
(65803) Didymos – Wikipedia
Dimorphos (Mond) – Wikipedia
Double Asteroid Redirection Test – Wikipedia
Hera (Raumfahrtmission) – Wikipedia
Vega (Rakete) – Wikipedia
Technology Readiness Level – Wikipedia
Modellbasiertes Systems Engineering – Wikipedia
Reaktionsrad – Wikipedia
Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia
Satellitenkollision am 10. Februar 2009 – Wikipedia
Starlink – Wikipedia
Kessler-Syndrom – Wikipedia
ESA - The Zero Debris Charter
Intelsat 29e – Wikipedia
Envisat – Wikipedia
Satellitenorbit – Wikipedia
Geosynchrone Umlaufbahn – Wikipedia
Friedhofsorbit – Wikipedia
RZ117 Euclid
Ein Weltraumteleskop auf der Suche nach dunkler Energie und dunkler Materie
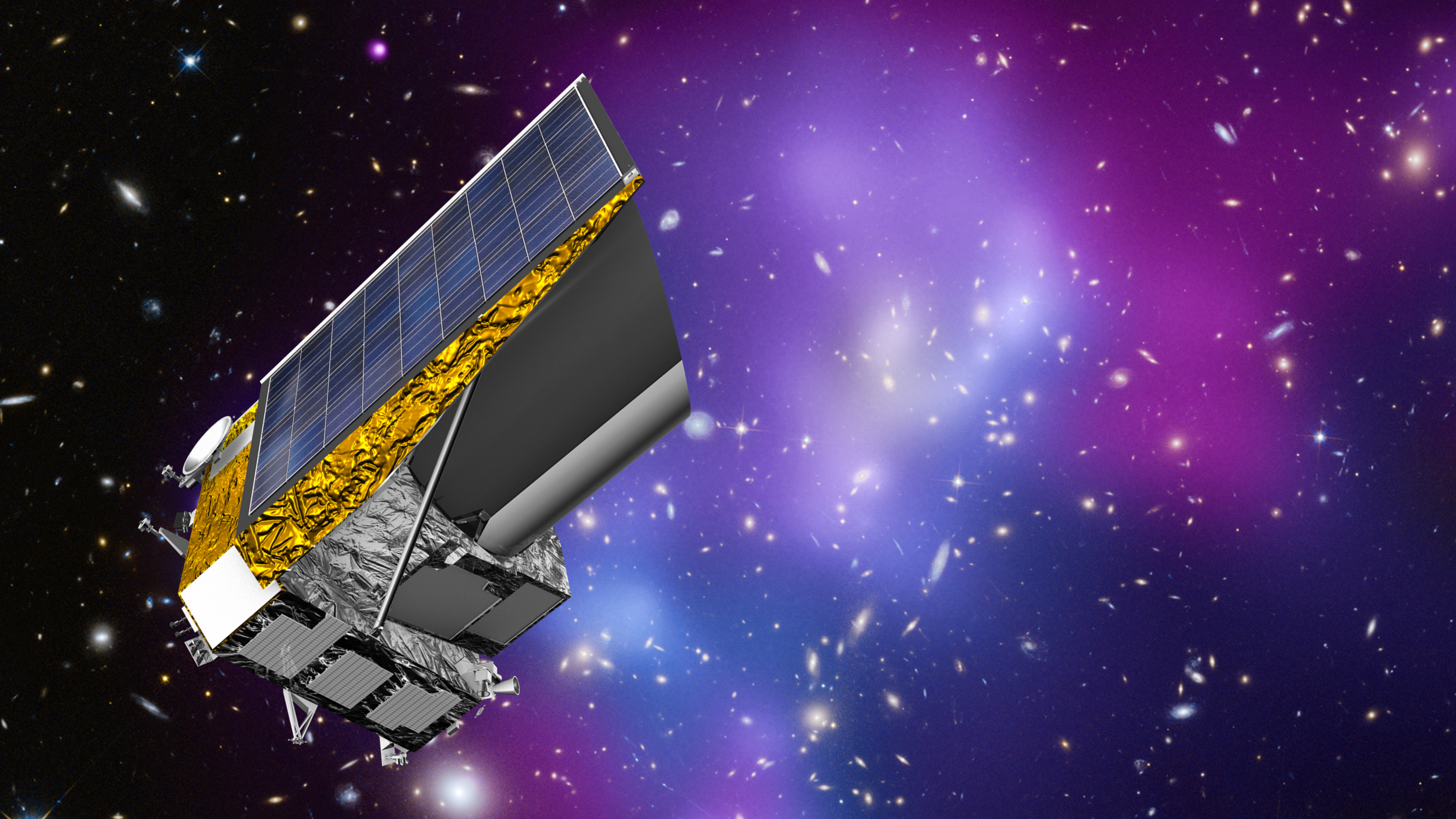
Die geometrische Vermessung des Universums kann eine Reihe von Erkenntnissen liefern, die Aufschluss über seine wahre Größe geben – und damit auch sowohl über seine kontinuierliche Ausdehnung als auch seine innere Beschaffenheit. Diesen Auftrag hat das jüngst gestartete Weltraumteleskop Euclid der ESA, das eine umfangreiche Beobachtung des Weltraums im visuellen sowie dem nahinfraroten Spektrum vornehmen wird.
Durch diese Himmelsdurchmusterung erhoffen sich die Astronomen weitere Daten zur Bestimmung der dunklen Energie als auch der dunklen Materie im All. Das gesammelte Datenmaterial wird darüberhinaus in bereitgestellten Katalogen den Forscherinnen und Forschern weltweit noch über Jahre hinaus eine Forschungsgrundlage sein.
Dauer:
1 Stunde
58 Minuten
Aufnahme:
23.10.2023

Knud Jahnke |
Auskünft über diese interessante Mission gibt Knud Jahnke, Leiter der Euclid-Missionsgruppe in der Galaxien- und Kosmologieabteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Knud erläutert uns die Ziele der Mission, das Design des Weltraumteleskops und seiner Instrumente und welche Fragen der Datenkatalog am Ende beantworten soll.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Whirlpool-Galaxie – Wikipedia
Sterne und Weltraum – Wikipedia
Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia
Shapley-Curtis-Debatte – Wikipedia
Standardkerze – Wikipedia
Supernova vom Typ Ia – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Dunkle Energie – Wikipedia
Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Wikipedia
Kosmologische Konstante – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
Urknall – Wikipedia
Modifizierte Newtonsche Dynamik – Wikipedia
Voyager-Sonden – Wikipedia
Quasar – Wikipedia
Gravitationslinseneffekt – Wikipedia
Baryonische akustische Oszillation – Wikipedia
Einsteinring – Wikipedia
Relativitätstheorie – Wikipedia
Hintergrundstrahlung – Wikipedia
Chladnische Klangfigur – Wikipedia
Gaia (Raumsonde) – Wikipedia
CCD-Sensor – Wikipedia
Weltraumforschung: Das Geheimnis der dunklen Energie – DW – 18.07.2012
Korsch-Teleskop – Wikipedia
Sojus (Rakete) – Wikipedia
Ariane 6 – Wikipedia
Falcon 9 – Wikipedia
Lagrange-Punkte – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Photometrie – Wikipedia
Hubble-Konstante – Wikipedia
RZ116 CERN: LHCb
Der LHCb-Detektor am CERN versucht Widersprüche des Universums zu klären
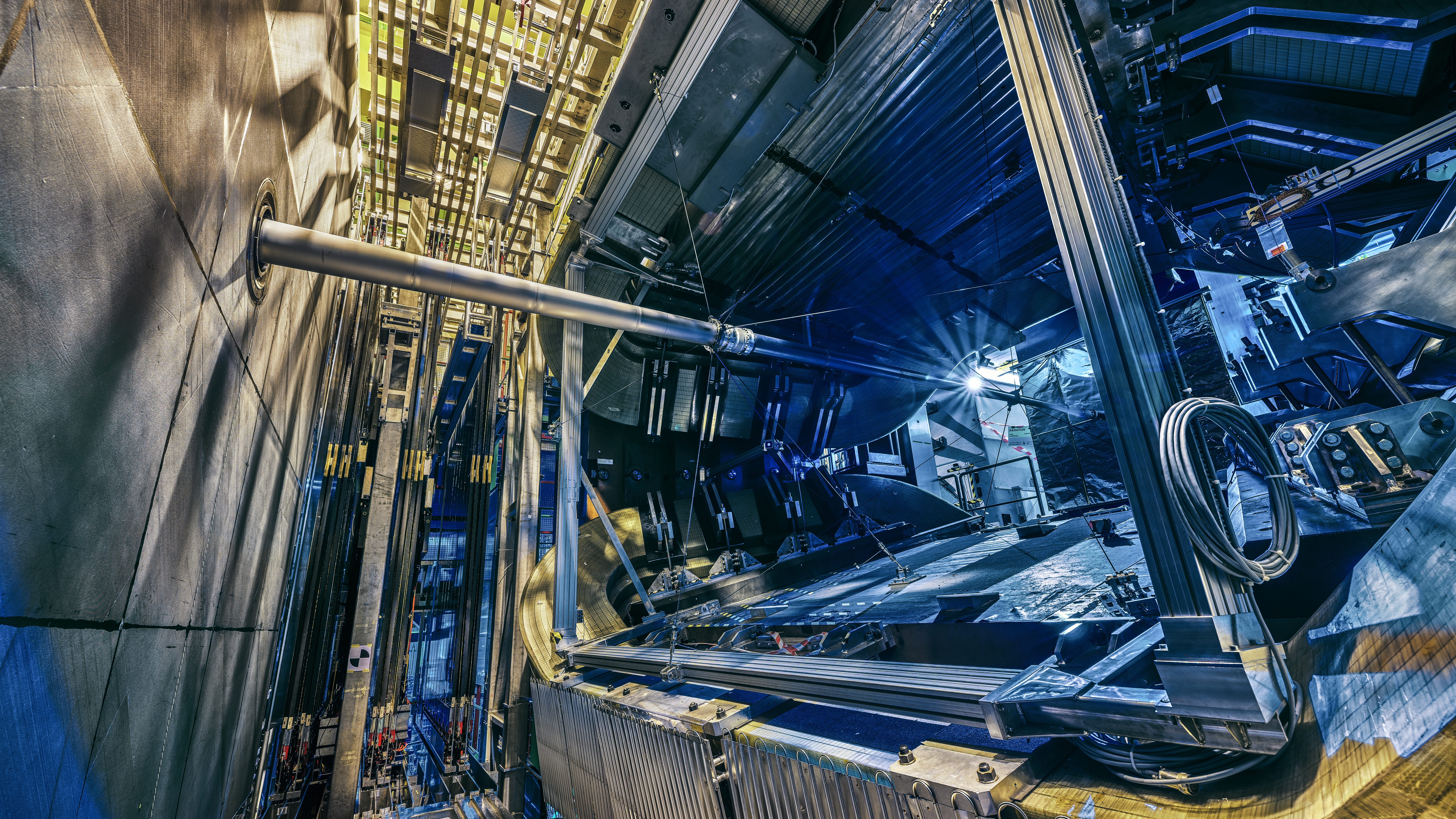
Eines der Rätsel der Kosmologie ist das Verhältnis von Materie zu Anti-Materie und warum es im Weltall mehr Materie als Anti-Materie gibt. Und man weiß, dass das Standardmodell der Physik zwar für unsere üblichen Energiebereiche gilt aber in der Dimension des Universums nicht alles erklärt. Um diese Widersprüche aufzudecken hat das CERN mit dem LHCB einen Detektor im Betrieb, der diese Grenzen der Physik ausloten und neue Erkenntnisse liefern soll.
Dauer:
1 Stunde
8 Minuten
Aufnahme:
26.04.2023

Patrick Koppenburg |
Patrick Koppenburg ist Operations Coordinator and Physics Coordinator beim LHCb-Experiment. Wir sprechen über Hintergrund und Technik des Detektors, welche Unklarheiten beim Verständnis der Physik hier ausgeräumt werden soll und welche Hoffnungen für die Langzeitergebnisse bestehen.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Quark (Physik) – Wikipedia
B-Fabrik – Wikipedia
CP-Verletzung – Wikipedia
Radioaktivität – Wikipedia
Positron – Wikipedia
Annihilation – Wikipedia
Alpha-Magnet-Spektrometer – Wikipedia
Hadron – Wikipedia
Myon – Wikipedia
Tscherenkow-Strahlung – Wikipedia
W-Boson – Wikipedia
Tetraquark – Wikipedia
Pentaquark – Wikipedia
Meson – Wikipedia
Quantenchromodynamik – Wikipedia
Gluon – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
RZ115 CERN: ATLAS
Aufbau, Funktion und Aufgabe des ATLAS-Detektors am CERN
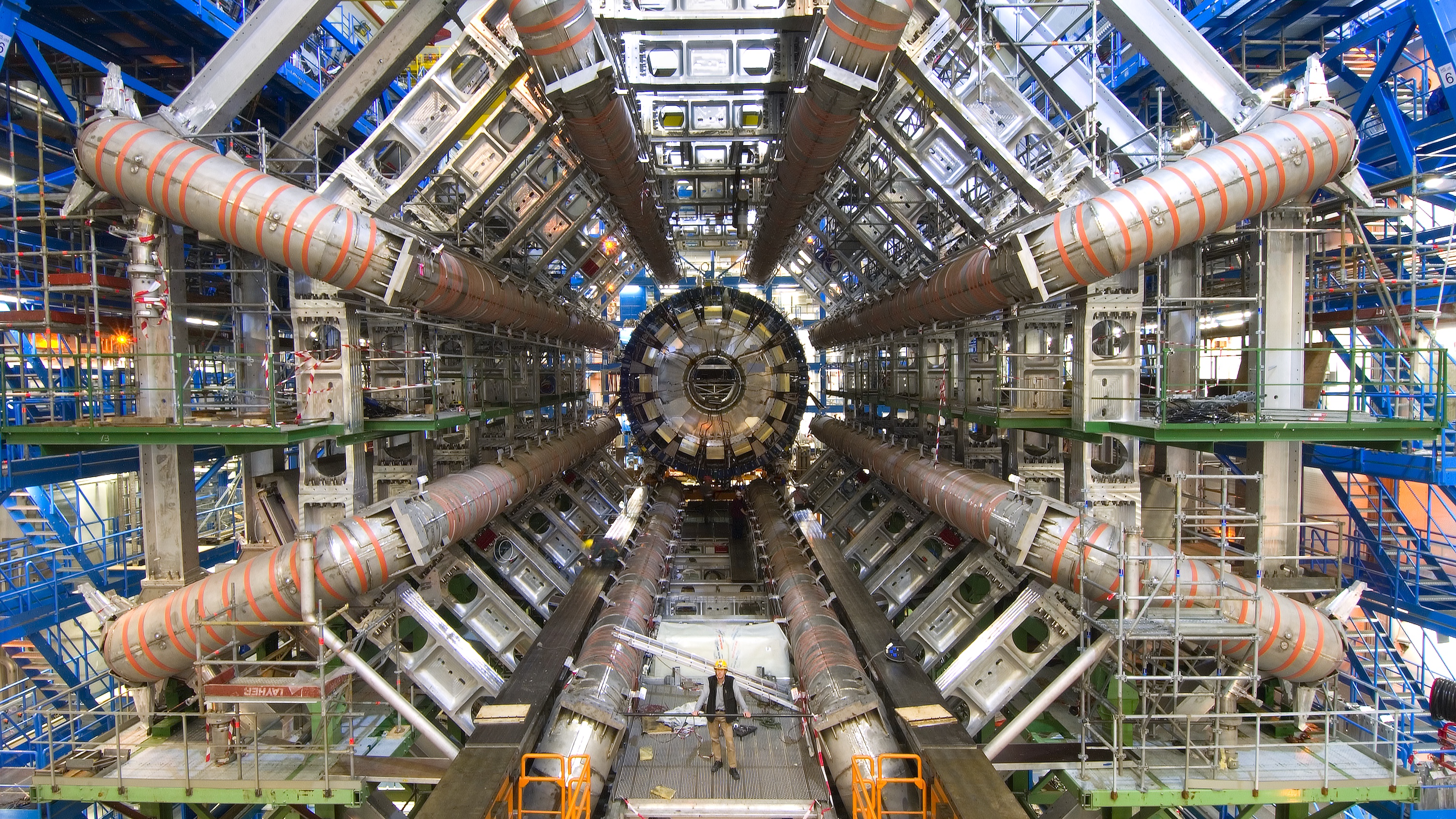
Nach dem CMS-Detektor ist ATLAS das zweite große Detektor-System am Large Hadron Collider am CERN in Genf, dass den Nachweis des Higgs-Bosons geliefert hat und mit seiner aufwändigen Technik auch heute noch weiter Teilchenkoliisionen beobachtet und damit aktiv zur Grundlagenforschung beiträgt.
Dauer:
1 Stunde
17 Minuten
Aufnahme:
26.04.2023

Christoph Rembser |
Wir sprechen mit Christoph Rembser, seit 2016 Leiter des ATLAS-Teams, über die Konzeptionsphase des Detektors, seinen internen Aufbau und die Unterschiede zu CMS, wie Kollisionsdetektion abläuft und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits gewonnen wurden und welche vielleicht noch gewonnen werden könnten.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Large Hadron Collider – Wikipedia
Geigenbauer – Wikipedia
ATLAS (Detektor) – Wikipedia
Tian’anmen-Massaker – Wikipedia
Deutsches Elektronen-Synchrotron – Wikipedia
HERA (Teilchenbeschleuniger) – Wikipedia
Elektron – Wikipedia
Myon – Wikipedia
Zylinderspule – Wikipedia
Kalorimeter – Wikipedia
Silicium – Wikipedia
Argon – Wikipedia
Ionisation – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Bullet Galaxy - Wikipedia
Future Circular Collider - Wikipedia
Supersymmetrie – Wikipedia
Hadron – Wikipedia
Lepton – Wikipedia
Austauschteilchen – Wikipedia
Graviton – Wikipedia
RZ114 CERN: CMS
Aufbau, Funktion und Aufgabe des CMS-Detektors am CERN
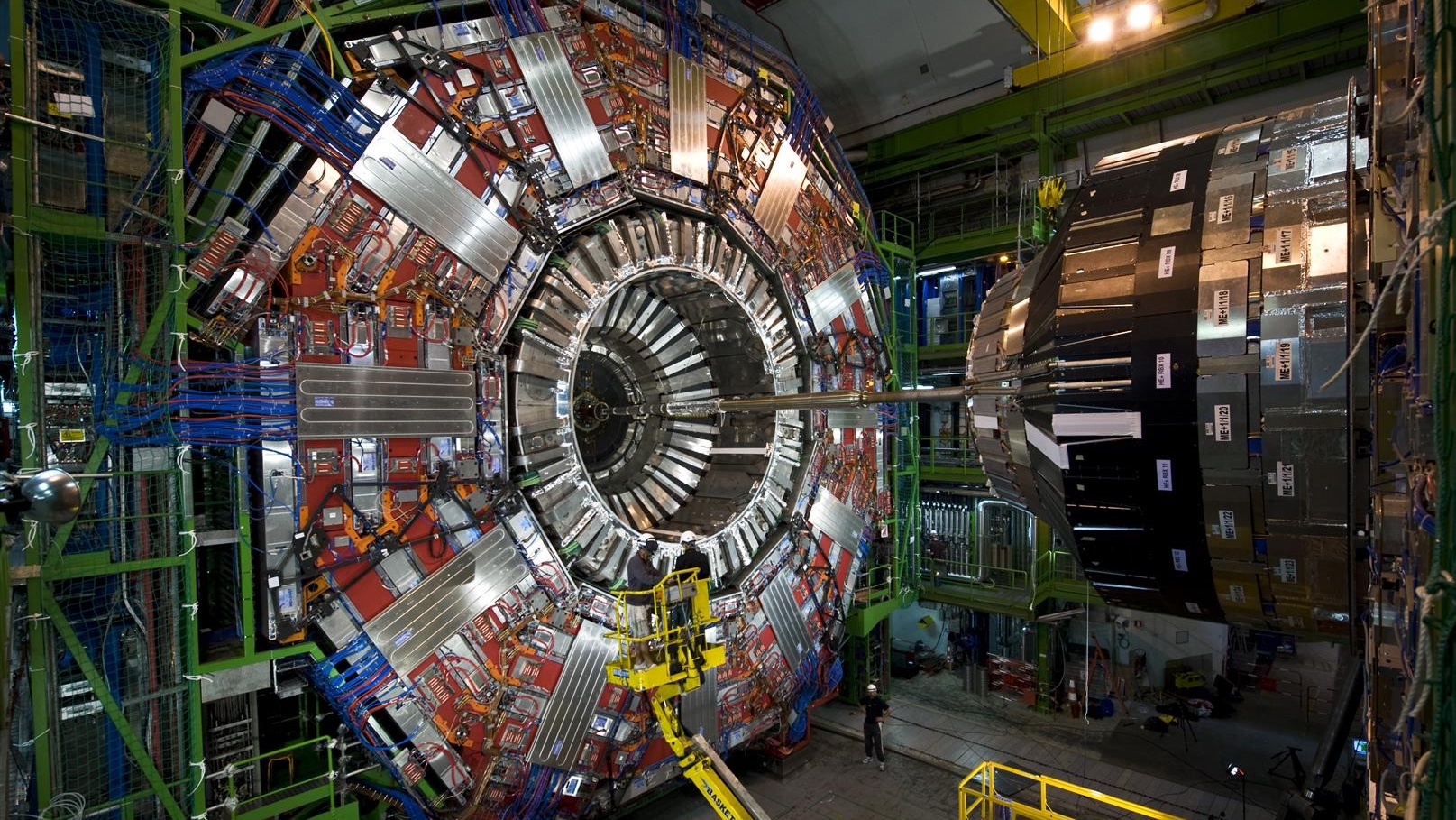
Der CMS (Compact Muon Solenoid) ist einer der beiden Detektoren, die gemeinsam den Nachweis des Higgs-Bosons ermöglicht haben und ist eine dieser gigantischen Strukturen 100m unter der Erde am CERN and dem die vom LHC beschleunigten Teilchen untersucht werden.
Dauer:
1 Stunde
43 Minuten
Aufnahme:
26.04.2023

Wolfgang Adam |
Wir sprechen mit Wolfgang Adam, dem stellvertretendem Sprecher CMS-Kollaboration, über die Planung, Bauphase und Design des Detektors, die Funktionsweise und Aufgaben der einzelnen Detektionsschichten und welchen Beitrag CMS zum Nachweis des Higgs-Bosons geleistet hat.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Compact Muon Solenoid – Wikipedia
RZ104 Cherenkov Telescope Array | Raumzeit
RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer
Standardmodell der Teilchenphysik – Wikipedia
Hadron – Wikipedia
Elektron – Wikipedia
Myon – Wikipedia
Zylinderspule – Wikipedia
Tesla (Einheit) – Wikipedia
Feldlinie – Wikipedia
CCD-Sensor – Wikipedia
Silicium – Wikipedia
Bleiwolframat – Wikipedia
Szintillator – Wikipedia
Myon – Wikipedia
Tauon – Wikipedia
Higgs-Boson – Wikipedia
Z-Boson – Wikipedia
Photon – Wikipedia
Quantenfeldtheorie – Wikipedia
Quark (Physik) – Wikipedia
W-Boson – Wikipedia
Symmetriebrechung – Wikipedia
Antiteilchen – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Neutrino – Wikipedia
RZ113 CERN: Der ALICE-Detektor
Das ALICE-Experiment auf der Suche nach dem Wunderland des Quark-Gluon-Plasmas

Das ALICE-Experiment ist eines der großen Detektorsysteme am CERN in Genf und nutzt den CERN-Beschleunigerring um die Kollision schwerer Ionen zu beobachten. Dabei entsteht ein sogenanntes Quark-Gluon-Plasma, in dem sich Atom zu einem Teilchenbrei vermengen wie man es vermutlich kurz nach dem Urknalls vorgefunden hat.
Dauer:
1 Stunde
42 Minuten
Aufnahme:
25.04.2023

Kai Schweda |
Wir sprechen mit Kai Schweda, derzeit der offizielle Sprecher und Projektleiter des ALICE-Teams am CERN. Wir schauen auf die physikalischen Hintergründe, die aufwändige Technik und Funktionsweise des Detektors, welche Ergebnisse das Experiment bisher schon hat liefern können und was für Aufgaben und technische Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
CERN – Wikipedia
ALICE – Wikipedia
Large Hadron Collider – Wikipedia
Higgs-Boson – Wikipedia
Proton – Wikipedia
Blei – Wikipedia
Schwerion – Wikipedia
Uran – Wikipedia
Feldlinie – Wikipedia
Xenon – Wikipedia
Quark (Physik) – Wikipedia
Schwache Wechselwirkung – Wikipedia
Starke Wechselwirkung – Wikipedia
Farbladung – Wikipedia
Streuexperiment – Wikipedia
Quark-Gluon-Plasma – Wikipedia
Urknall – Wikipedia
Beryllium – Wikipedia
Lorentzkraft – Wikipedia
Pion – Wikipedia
Zylinderspule – Wikipedia
Spurendriftkammer – Wikipedia
Plancksches Strahlungsgesetz – Wikipedia
Antiteilchen – Wikipedia
Quantenchromodynamik – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Dunkle Energie – Wikipedia
Standardmodell der Teilchenphysik – Wikipedia
RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer | Raumzeit
Neutronenstern – Wikipedia
RZ112 CERN: Die Beschleuniger-Kette
Die größte Maschine der Welt ist die Basis der Forschung am CERN
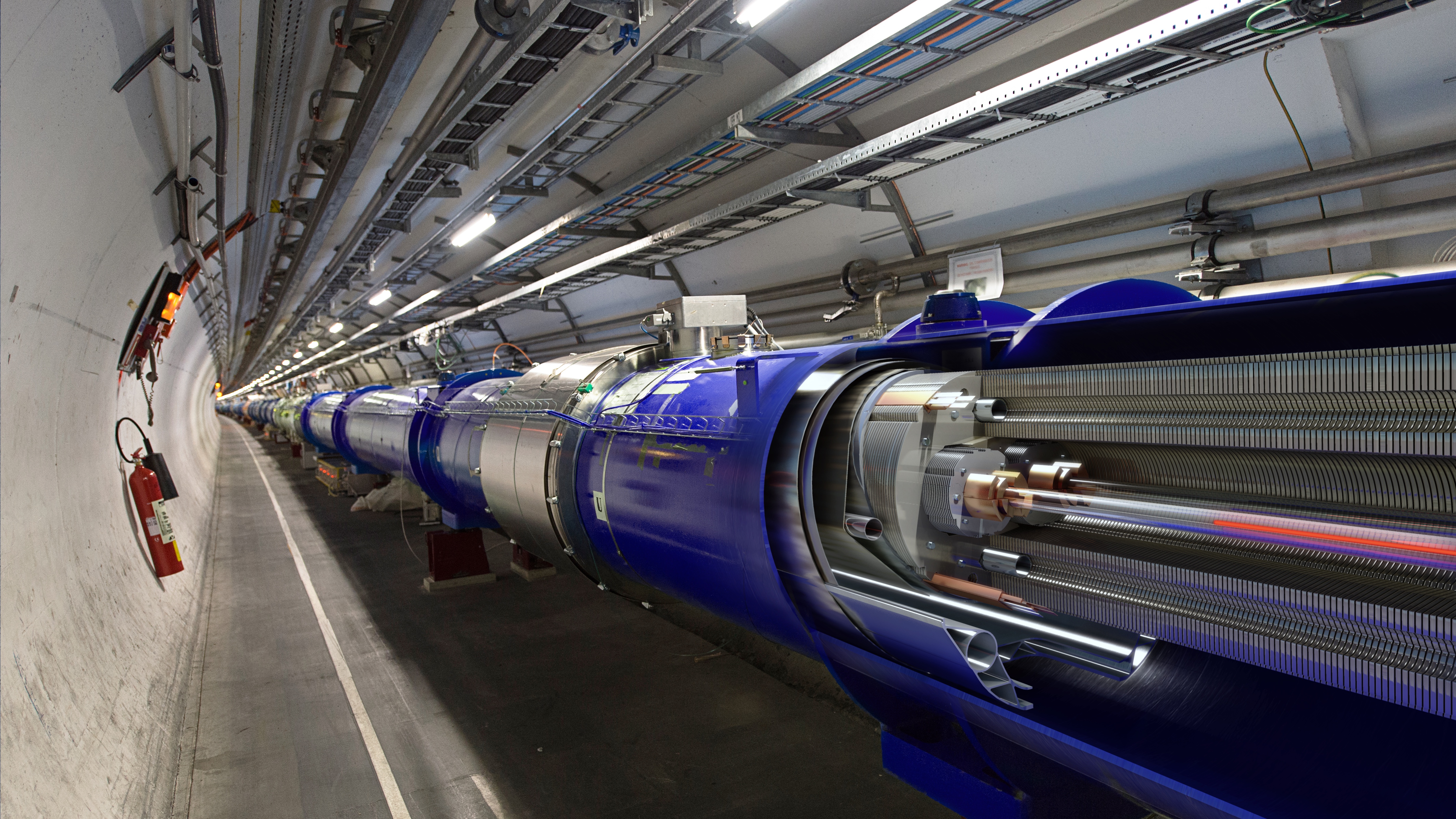
Die Beschleunigung von Teilchen ist die Grundlage für die Forschung am CERN. Eine Kaskade von miteinander verbundenen Ringen wird dabei zur Schnellstraße für beschleunigte Elektronen oder Ionen und bauen dabei sukzessive die Energie auf, die letztlich in einer Kollision freigesetzt wird und die Experimente am CERN ermöglicht.
Daher sind Aufbau, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung dieser komplexen Maschine ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit am CERN.
Dauer:
1 Stunde
39 Minuten
Aufnahme:
25.04.2023

Alexander Huschauer |
Wir sprechen mit Alexander Huschauer, zuständig für den Betrieb und Wartung des CERN Proton Synchrotron, über Sinn, Design, Aufbau, Betrieb, Wartung und Anwendung von Teilchenbeschleunigern im Allgemeinen und den Beschleunigern am CERN im besonderen.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
CERN – Wikipedia
Teilchenbeschleuniger – Wikipedia
Proton Synchrotron – Wikipedia
Super Proton Synchrotron – Wikipedia
Large Hadron Collider – Wikipedia
Radio-frequency quadrupole - Wikipedia
Linearbeschleuniger – Wikipedia
Dipol (Physik) – Wikipedia
Quadrupol – Wikipedia
ISOLDE – Wikipedia
Neodym – Wikipedia
Titan (Element) – Wikipedia
Kollimator – Wikipedia
Tevatron – Wikipedia
Relativistic Heavy Ion Collider - Wikipedia
Radionuklid – Wikipedia
Positronen-Emissions-Tomographie – Wikipedia
Strahlentherapie – Wikipedia
RZ111 CERN: Geschichte und Erfolge
Das CERN in Genf und die Grundlagenforschung für Teilchenphysik
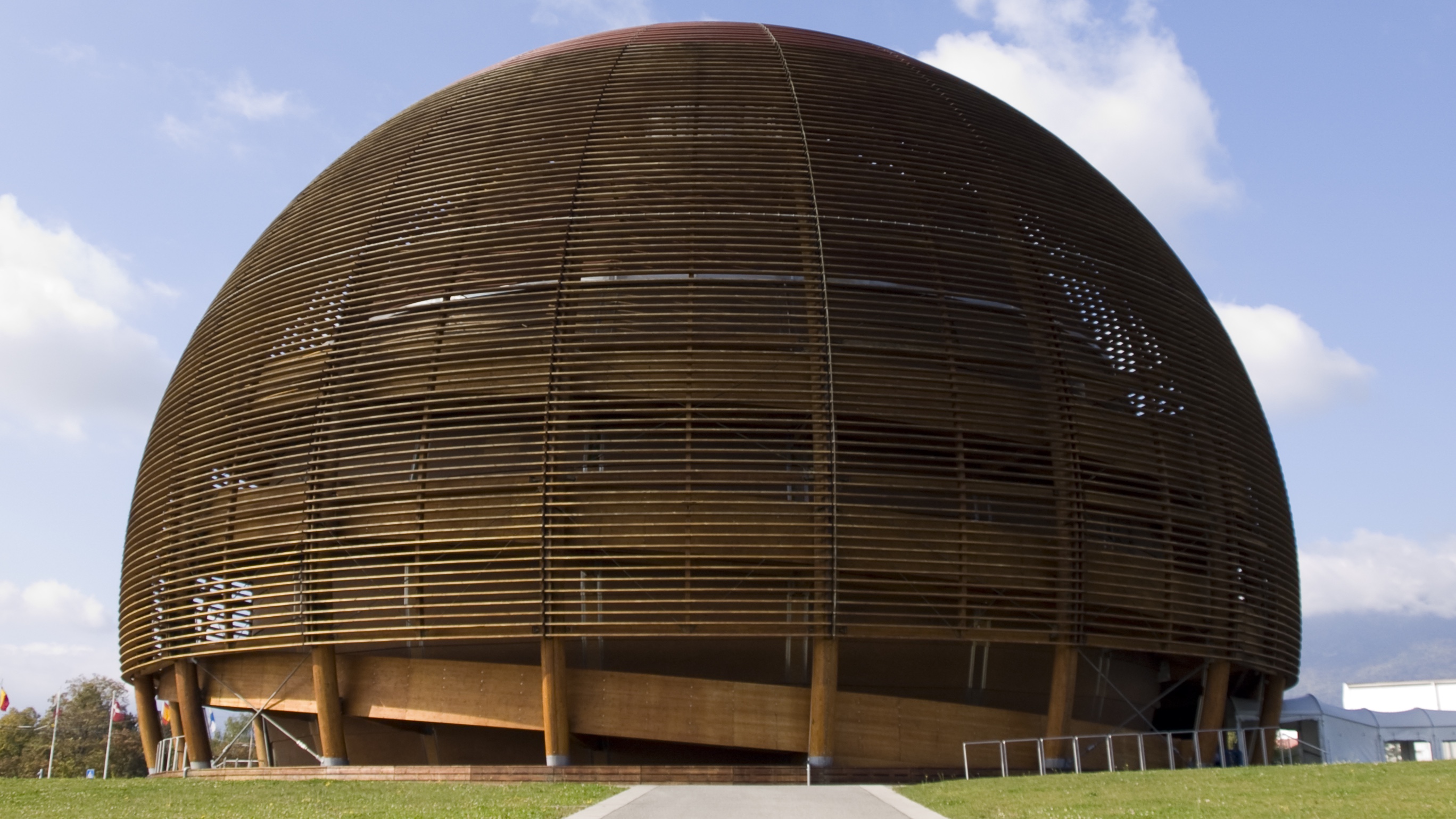
1954 gegründet, war das CERN von Anfang an Friedens- und Forschungsprojekt in einem. Der aufsteigenden Bedeutung der Kernforschung trug dieser neue Standort in Genf Rechnung und versammelte Wissenschaftler aus Europa und aller Welt, um zu erforschen, was die Welt im innersten zusammenhält. In seiner über 70-jährigen Geschichte konnte das CERN nicht nur grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse liefern sondern machte auch durch nebenläufige Durchbrüche wie die Erfindung des World Wide Webs von sich reden. Als 2012 durch die Experimente am CERN auch noch das lang gesuchte Higgsfeld bestätigt und damit der letzte gesuchte Baustein des Standardmodells der Teilchenphysik gefunden wurde, hatte das CERN die Aufmerksamkeit der ganzen Welt und steht seitdem wie kein anderer Standort für die Bedeutung der Grundlagenforschung in der Wissenschaft.
Dauer:
1 Stunde
37 Minuten
Aufnahme:
24.04.2023
Manfred Krammer ist Leiter des Experimental Physics Department am CERN, das die Schnittstelle zu allen wichtigen Gruppen innerhalb des CERN darstellt. Wir sprechen über die Geschichte des CERN und die Anfänge der Grundlagenforschung in der Teilchenphysik, über die ersten Meilensteine des CERN und die Besonderheit der Entdeckung des Higgsfelds.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
CERN – Wikipedia
Myon – Wikipedia
Synchro-Zyklotron (CERN) – Wikipedia
Relativitätstheorie – Wikipedia
Atom – Wikipedia
Elektron – Wikipedia
Elementarteilchen – Wikipedia
Periodensystem – Wikipedia
Standardmodell der Teilchenphysik – Wikipedia
Rutherford-Streuung – Wikipedia
Teilchenbeschleuniger – Wikipedia
Hadron – Wikipedia
Meson – Wikipedia
Pion – Wikipedia
Kaon – Wikipedia
Kosmische Strahlung – Wikipedia
RZ104 Cherenkov Telescope Array | Raumzeit
Proton Synchrotron – Wikipedia
Large Hadron Collider – Wikipedia
Super Proton Synchrotron – Wikipedia
Hohlraumresonator – Wikipedia
Fundamentale Wechselwirkung – Wikipedia
Schwache Wechselwirkung – Wikipedia
Z-Boson – Wikipedia
Blasenkammer – Wikipedia
Elektroschwache Wechselwirkung – Wikipedia
Neutrino – Wikipedia
Heureka – Wikipedia
World Wide Web – Wikipedia
Higgs-Mechanismus – Wikipedia
Future Circular Collider - Wikipedia
RZ110 Grenzen des menschlichen Körpers
Die Physiologie des Mensch in extremen Situationen

Der Mensch ist eine Erfolgsgeschichte der Evolution und hat bewiesen, dass er sich an die unterschiedlichsten Extrembedingungen gut anpassen kann. Trotzdem gibt es Grenzen, die schlicht durch die Biologie vorgegeben werden und mit denen man sich arrangieren muss, wenn man den Körper unter hohe Belastung stellt.
Was sind die Gründe für diese Beschränkungen und unter welchen Bedingungen können diese Grenzen ausgeweitet oder durch Technologie überwunden werden? Die Beschränkungen auf der Erde sind dann im Weltraum noch einmal deutlich kniffliger und müssen bei Astronauten im Orbit und bei künftigen Mondmissionen bedacht werden.
Dauer:
2 Stunden
16 Minuten
Aufnahme:
06.04.2023

Hanns-Christian Gunga |
Hanns-Christian Gunga, Hochschullehrer für Weltraummedizin und extreme Umwelten am Zentrum für Weltraummedizin an der Charité Berlin, erläutert die Auswirkungen von Temperatur, Nahrungsentzug und Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper und warum wir in bestimmten Bereichen so schnell an unsere Grenzen stossen.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Geologie – Wikipedia
Paläontologie – Wikipedia
RZ075 Geologische Zeit | Raumzeit
Dinosaurier – Wikipedia
Jurassic Park – Wikipedia
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie – Wikipedia
Parabelflug – Wikipedia
Reflexionsarmer Raum – Wikipedia
Sensorische Deprivation – Wikipedia
Floating – Wikipedia
Erythrozyt – Wikipedia
Elektrolyt – Wikipedia
Ayran – Wikipedia
Lassi – Wikipedia
Seerechtsübereinkommen – Wikipedia
Fasten – Wikipedia
Hungerkünstler – Wikipedia
Chronobiologie – Wikipedia
Hypothalamus – Wikipedia
Sommerzeit – Wikipedia
Jetlag – Wikipedia
RZ027 Mars500 | Raumzeit
Circadiane Rhythmik – Wikipedia
Waleri Wladimirowitsch Poljakow – Wikipedia
Artemis-Programm – Wikipedia
Regolith – Wikipedia
RZ010 Raumstationen | Raumzeit
RZ021 Weltraummedizin | Raumzeit
Titan (Mond) – Wikipedia
Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) – Wikipedia
RZ006 Erdbeobachtung | Raumzeit
RZ042 Copernicus/GMES | Raumzeit
RZ109 Quantentechnologie für die Raumfahrt
Quantenmechanische Eigenschaften dienen zunehmend als Basis moderner Technologien
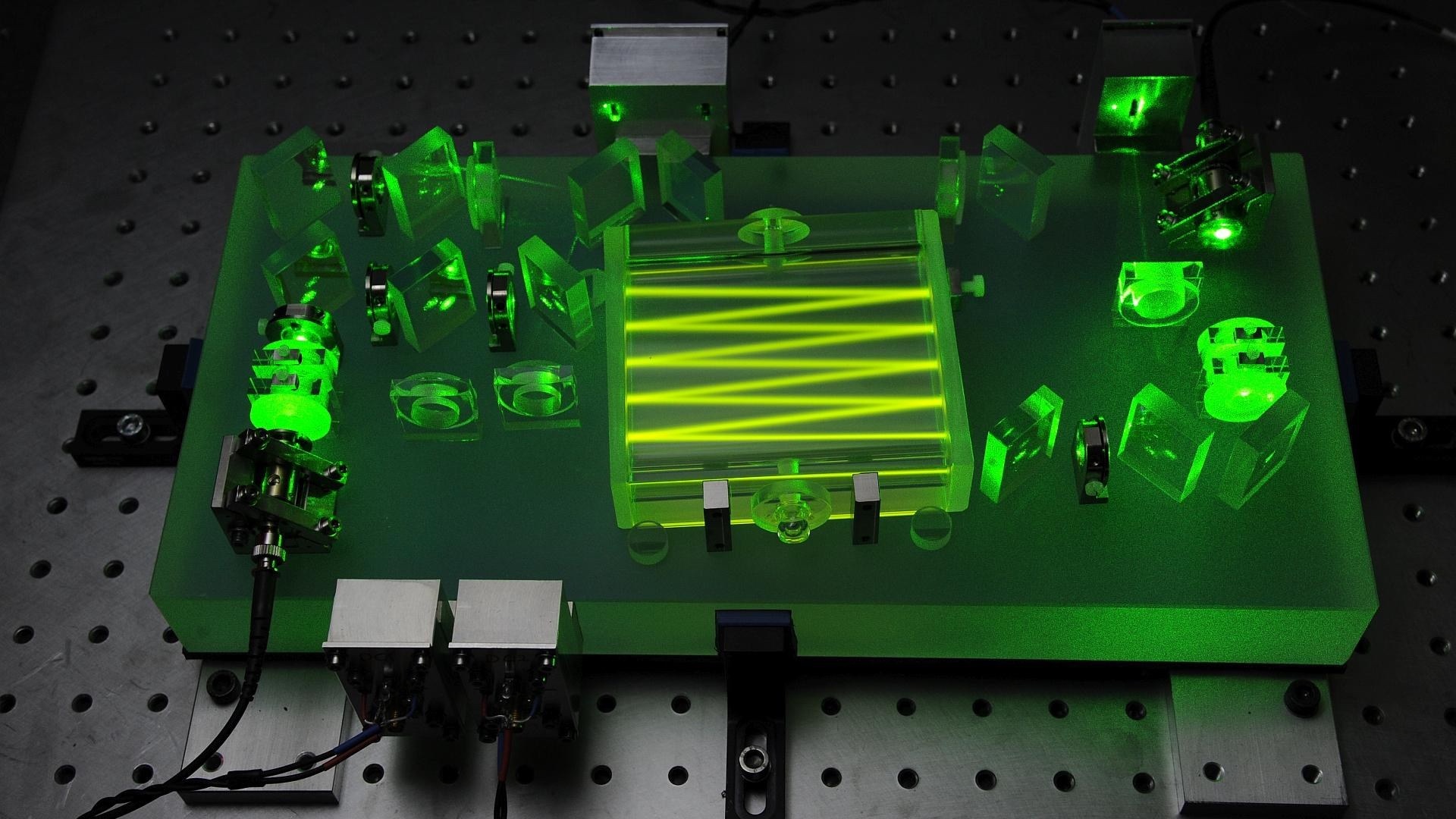
Die Grundlagenforschung im Bereich der Quantenmechanik ist in den letzten Jahrzehnten weit vorangeschritten und die gewonnenen Erkenntnisse dienen der Entwicklung neuer Technologien, die der Raumfahrt künftig noch genauere Mess- und Steuerinstrumente verspricht.
Doch auch auf der Erde werden diese Erkenntnisse und Technologien ihre Spuren hinterlassen, sobald sie sich im All bewährt haben. Das DLR hat gleich mehrere Institute gegründet um in diesem Bereich weitere Fortschritte zu erzielen und ganz konkrete Ansätze für die kommende Produktentwicklung zu liefern.
Dauer:
1 Stunde
36 Minuten
Aufnahme:
24.03.2023

Lisa Wörner |
Wir sprechen mit der stellvertretenden Leiterin des Instituts für Quantentechnologie des DLR in Ulm Lisa Wörner. Sie stellt die Arbeit des Instituts vor und erläutert, in welchen Bereichen Quantenmechanik heute schon ein Rolle spielt, welche Anwendungen Quantentechnologie in naher Zukunft abdecken wird und was die Hintergründe und Ziele der Raumfahrtexperimente COMPASSO und BECCAL sind.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
DLR - Institut für Quantentechnologien
Facility for Antiproton and Ion Research - Wikipedia
CERN – Wikipedia
Large Hadron Collider – Wikipedia
ALICE – Wikipedia
Der große Entwurf – Wikipedia
Doppelspaltexperiment – Wikipedia
Fullerene – Wikipedia
Welle-Teilchen-Dualismus – Wikipedia
Wellenfunktion – Wikipedia
Quantenmechanik – Wikipedia
Interferenz (Physik) – Wikipedia
RZ008 Satellitennavigation | Raumzeit
Globales Navigationssatellitensystem – Wikipedia
Global Positioning System – Wikipedia
Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia
Institute of Quantum Technologies - COMPASSO
Frequenzkamm – Wikipedia
Bose-Einstein-Kondensat – Wikipedia
Fermion – Wikipedia
Boson – Wikipedia
LIGO – Wikipedia
Laser Interferometer Space Antenna – Wikipedia
Gravity field and steady-state ocean circulation explorer – Wikipedia
GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
Quantenverschränkung – Wikipedia
JUICE (Raumsonde) – Wikipedia
RZ108 NASA
Einblicke in die Arbeit und Wahrnehmung der NASA und die Rolle der Wissenschaftsdirektion

Die NASA spielt in der Raumfahrt eine herausragende und damit führende Rolle. Keine andere Raumfahrtagentur und Wissenschaftsorganisation steht sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit so für Erfolg und Exzellenz.
Nach einer Reihe sehr erfolgreicher Missionen stehen im Rahmen einer sich ändernden Weltpolitik (die Rolle Russlands verändert sich und die Kooperation mit China bleibt schwierig) und wirtschaftlicher Veränderungen (zunehmende Privatisierung im Raumfahrtbetrieb) alle Agenturen - und damit auch die NASA vor neuen Herausforderungen.
Dauer:
1 Stunde
34 Minuten
Aufnahme:
24.02.2023

Thomas Zurbuchen |
Ich spreche mit Thomas Zurbuchen Er war von Oktober 2016 bis Ende 2022 der Wissenschaftsdirektor der NASA und hat in der Zeit an zahlreichen großen Missionen gearbeitet, darunter bahnbrechende Projekte wie Perseverance und Ingenuity und den Start des James-Webb-Teleskop.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Thomas Zurbuchen – Wikipedia
289116 Zurbuchen - Wikidata
Apollo 11 – Wikipedia
Neil Armstrong – Wikipedia
Buzz Aldrin – Wikipedia
Magnetosphäre – Wikipedia
Sonnenwind – Wikipedia
SpaceX – Wikipedia
Kiko Dontchev | LinkedIn
Enceladus (Mond) – Wikipedia
Josef Aschbacher – Wikipedia
RZ042 Copernicus/GMES | Raumzeit
Schiaparelli (Marslander) – Wikipedia
RZ083 SpaceX | Raumzeit
Mars 2020 – Wikipedia
Ingenuity (helicopter) - Wikipedia
Dragonfly (spacecraft) - Wikipedia
Voyager-Programm – Wikipedia
MAVEN – Wikipedia
New Horizons – Wikipedia
Zodiakallicht – Wikipedia
Starlink – Wikipedia
OneWeb – Wikipedia
Projekt Kuiper – Wikipedia
Weltraumrecht – Wikipedia
Space Shuttle – Wikipedia
Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia
Nancy Grace Roman Space Telescope – Wikipedia
NASA, SpaceX to Study Hubble Telescope Reboost Possibility
RZ107 Artemis und Orion
Mit der Artemis-Mission wagt die NASA gemeinsam mit der ESA die Rückkehr zum Mond

50 Jahre nach der letzten Landung auf dem Mond macht sich die NASA auf wiederum Menschen auf den Mond zu senden. Die Artemis-Mission setzt dabei zunächst auf drei konsekutive Missionen, die sich diesem Ziel schrittweise annähert. Das Projekt ist aber auch eine enge Kooperation mit der ESA, die mit dem European Service Modul eine der wichtigsten Komponenten stellt. Das Modul sorgt für den Antrieb des Raumfahrzeugs und versorgt das Crew-Modul der Astronauten mit allen lebenserhaltenden Funktionen. Die Artemis 1 Mission ist Ende 2022 erfolgreich abgeschlossen worden und alles bereitet sich nun auf den ersten bemannten Flug zum Mond seit einem halben Jahrhundert vor.
Dauer:
1 Stunde
52 Minuten
Aufnahme:
16.01.2023

Tobias Langener |
Ich spreche mit Tobias Langener von ESA, der verantwortlich für die Antriebssysteme des Orion European Service Modules am Projekt mitgearbeitet hat über die lange Vorgeschichte von Artemis, die technischen Herausforderungen des Projekts und dem erfolgreichen Verlauf der Artemis 1 Mission und welche Erkenntnisse diese geliefert hat.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia
ExoMars – Wikipedia
Constellation-Programm – Wikipedia
Orion (Raumschiff) – Wikipedia
Artemis-Programm – Wikipedia
Artemis 1 – Wikipedia
Space Launch System – Wikipedia
Falcon 9 – Wikipedia
Falcon Heavy – Wikipedia
Saturn V - Wikipedia
Lunar Orbital Platform-Gateway – Wikipedia
Apollo-Programm – Wikipedia
Lockheed Martin – Wikipedia
Airbus – Wikipedia
Atlantis (Raumfähre) – Wikipedia
RZ003 Raketenantriebe | Raumzeit
Apollo 13 – Wikipedia
OHB – Wikipedia
White Sands Missile Range – Wikipedia
Kennedy Space Center – Wikipedia
Swing-by – Wikipedia
RZ098 Geschichte der Europäischen Raumfahrt | Raumzeit
Entfernter rückläufiger Orbit – Wikipedia
ESA Television - Videos - 2020 - 01 - Forward to the Moon with ESA - Animation: the Artemis 1 mission
The Crazy Journey of Artemis 1 - YouTube
Snoopy - Wikipedia
Shaun das Schaf – Wikipedia
Non-ballistic atmospheric entry - Wikipedia
Artemis 2 – Wikipedia
HAL 9000 – Wikipedia
Artemis 3 – Wikipedia
SpaceX – Wikipedia
Starship (Rakete) – Wikipedia
Dragon (Raumschiff) – Wikipedia
RZ106 Der Gaia-Sternkatalog 2
Das Data Release 3 des Gaia-Sternkatalogs öffnet die Tür in das Universum weiter als zuvor
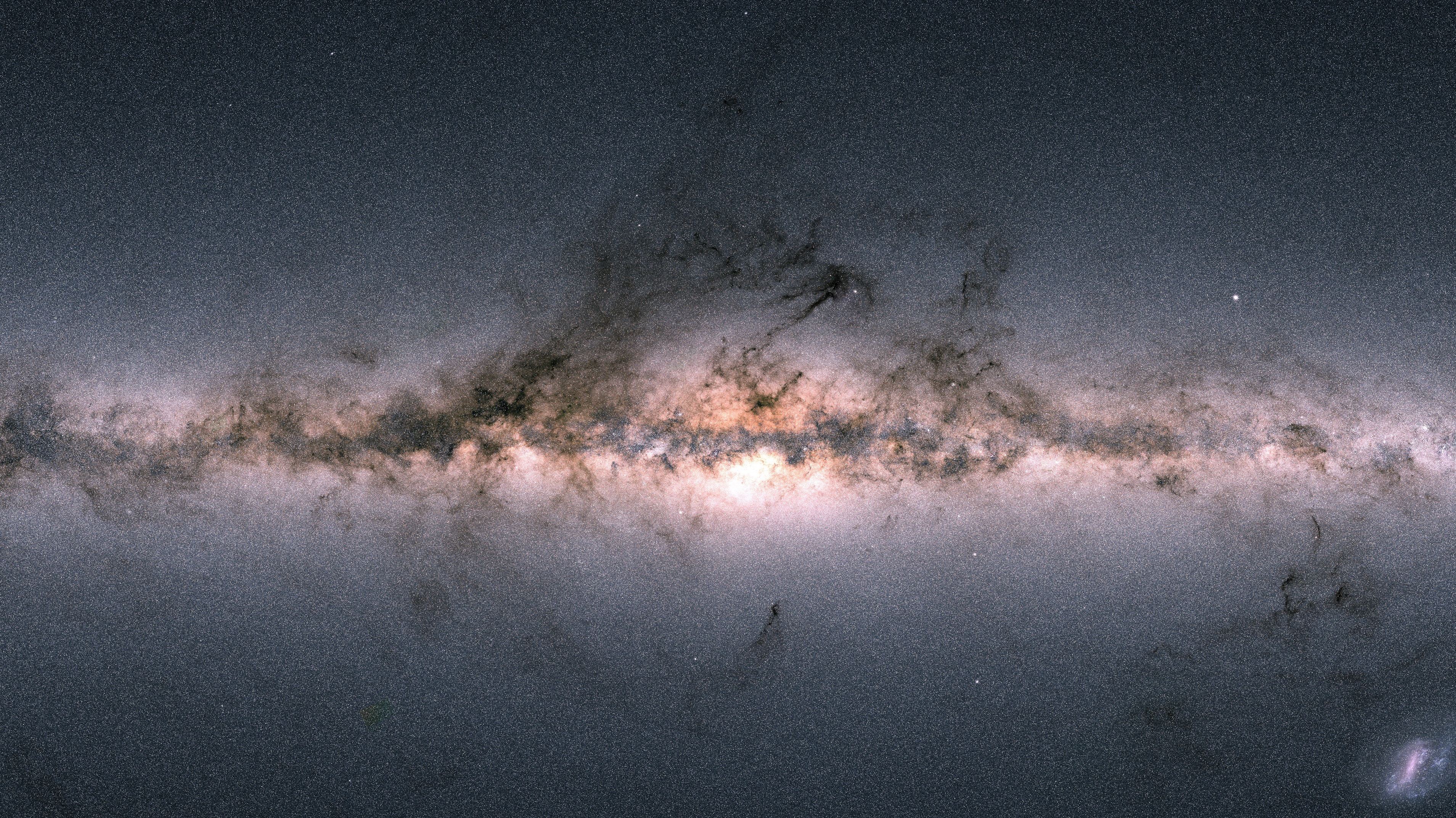
Die Sendung ist eine Fortsetzung von RZ076 über den Gaia-Mission und den daraus entstehenden Sternkatalog, dessen Inhalt die astronomische Forschung weltweit mit einer Druckbetankung von Daten versorgt und ganz neue Forschung ermöglicht. Das Data Release 3 diesen Jahres erweitert den bisher schon verfügbaren Datenreichtum um ganz neue Messungen und verbessert dazu die bereits veröffentlichten Daten.
Dauer:
2 Stunden
26 Minuten
Aufnahme:
02.12.2022

Stefan Jordan |
Stefan Jordan vom Astronomischen Rechen-Institut vom Zentrum für für Astronomie ist wieder dabei und berichtet, welchen Weg die Gaia-Mission in der Zwischenzeit gegangen ist und welche technischen Probleme es bisher gegeben hat und wie diese gelöst werden konnten. Und wir sprechen über die Qualität des neuen Datenmaterials und die Vielzahl an neuen Erkenntnissen, die die Wissenschaft bereits hat aus dem Projekt gewinnen können.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
RZ076 Der Gaia-Sternkatalog
Astronomisches Rechen-Institut: Zentrum für Astronomie
Gaia (Raumsonde) – Wikipedia
Gaia Early Data Release 3 - Gaia Catalogue of Nearby Stars - Orbits - YouTube
The Warped Galactic Disc of the Milky Way Wobbles Like a Spinning Top - YouTube
Lagrange-Punkte – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
Streulicht – Wikipedia
Fokus – Wikipedia
Umlaufbahn – Wikipedia
Punktspreizfunktion – Wikipedia
Quasar – Wikipedia
Parallaxe – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Doppelstern – Wikipedia
Veränderlicher Stern – Wikipedia
Klassifizierung der Sterne – Wikipedia
Ausgleichungsrechnung – Wikipedia
Rektaszension – Wikipedia
Deklination (Astronomie) – Wikipedia
Milchstraße – Wikipedia
Radialgeschwindigkeit – Wikipedia
Andromedagalaxie – Wikipedia
Spiralarm – Wikipedia
Gaia Sausage - Wikipedia
Sternhaufen – Wikipedia
Sagittarius-Zwerggalaxie – Wikipedia
Metallizität – Wikipedia
Sternstrom – Wikipedia
Rotverschiebung – Wikipedia
Urknall – Wikipedia
Dunkle Energie – Wikipedia
Doppler-Effekt – Wikipedia
Zwerggalaxie – Wikipedia
Lokale Gruppe – Wikipedia
Dreiecksnebel – Wikipedia
Messier 87 – Wikipedia
Asteroid – Wikipedia
Exzentrizität (Astronomie) – Wikipedia
Planet Neun – Wikipedia
Transneptunisches Objekt – Wikipedia
(90377) Sedna – Wikipedia
(136472) Makemake – Wikipedia
Winkelsekunde – Wikipedia
Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Hot Jupiter – Wikipedia
Polarstern – Wikipedia
Sirius – Wikipedia
Donaldismus – Wikipedia
Erika Fuchs – Wikipedia
(31175) Erikafuchs – Wikipedia
Carl Barks – Wikipedia
(2730) Barks – Wikipedia
Europäisches Weltraumastronomiezentrum – Wikipedia
HEALPix - Wikipedia
HEALPix - Features
New method finds black hole closest to Earth | Max-Planck-Gesellschaft
Akkretionsscheibe – Wikipedia
Röntgenstrahlung – Wikipedia
Maschinelles Lernen – Wikipedia
Neuronales Netz – Wikipedia
Gravitationslinseneffekt – Wikipedia
2022-11-09 Gaia Collaboration to receive 2023 Berkeley Prize - Gaia - Cosmos
Hipparcos – Wikipedia
Säulen der Schöpfung – Wikipedia
RZ105 Neutronensterne 2
Ein weiterer Blick auf Neutronensterne aus der Perspektive der Theoretischen Physik

Neutronensterne waren bei Raumzeit bereits ein Thema, jetzt wagen wir einen zweiten Aufschlag, da sich in diesem Feld in den letzten Jahren so einiges getan hat und neue Teleskop-Projekte sowie Forschungstechniken aufgerufen werden. Und insbesondere die direkte Beobachtung einer Kilonova, der Kollision zweier Neutronesterne, hat dieses Wissenschaftsgenre neu durchgemischt.
Dauer:
1 Stunde
53 Minuten
Aufnahme:
15.04.2022

Vanessa Graber |
Ich spreche mit Vanessa Graber, theoretische Astrophysikerin und Spezialistin für Neutronenstern-Forschung am Institute of Space Sciences (CSIC) in Barcelona. Wir tauchen ein in die Geschichte und Theorie von Neutronensterne und erläutern die jüngsten Entdeckungen und Ereignisse und blicken zuletzt in die Zukunft eines „Raumzeit-GPS“, dass sich am Hintergrundrauschen der Gravitationsechos des Universums selbst orientiert.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Suprafluidität – Wikipedia
Supraleiter – Wikipedia
Europäischer Forschungsrat – Wikipedia
Neutronenstern – Wikipedia
Walter Baade – Wikipedia
Fritz Zwicky – Wikipedia
Supernova – Wikipedia
Kernfusion – Wikipedia
Silicium – Wikipedia
Eisen – Wikipedia
Proton – Wikipedia
Neutron – Wikipedia
Elektron – Wikipedia
Neutrino – Wikipedia
Energieerhaltungssatz – Wikipedia
Kernphotoeffekt – Wikipedia
Jocelyn Bell Burnell – Wikipedia
Elektromagnetische Störung – Wikipedia
Pulsar – Wikipedia
PSR J1921+2153 – Wikipedia
Schwarzes Loch – Wikipedia
Einsteinsche Feldgleichungen – Wikipedia
Weißer Zwerg – Wikipedia
Erhaltungssatz – Wikipedia
Drehimpuls – Wikipedia
Krebsnebel – Wikipedia
PSR J0835-4510 – Wikipedia
Standardkerze – Wikipedia
Magnetischer Fluss – Wikipedia
Weißer Zwerg – Wikipedia
Maxwell-Gleichungen – Wikipedia
Dipol (Physik) – Wikipedia
LIGO – Wikipedia
Zustandsgleichung – Wikipedia
PSR J1915+1606 – Wikipedia
Raumzeit – Wikipedia
Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia
Gammablitz – Wikipedia
Fermi Gamma-ray Space Telescope – Wikipedia
Kilonova – Wikipedia
Square Kilometre Array – Wikipedia
Pulsar timing array - Wikipedia
Global Positioning System - Wikipedia
Magellansche Wolken – Wikipedia
Wolfram Alpha – Wikipedia
Sternsensor – Wikipedia
Voyager Golden Record – Wikipedia
Stringtheorie – Wikipedia
Inflation (Kosmologie) – Wikipedia
RZ104 Cherenkov Telescope Array
Bodengestütze Gammastrahlen-Teleskope erweitern die Multimessenger-Astronomie

Gammateleskope suchen im Weltraum schon seit Jahrzehnten nach hochenergetischen Gammastrahlenquellen und erweitern damit unseren Blick auf das Universum. Auch Kosmische Teilchenstrahlung lässt sich so indirekt nachweisen.
Da die Erde die Gammastrahlen durch ihre Atmosphäre weitgehend abschirmt, müssen sich bodengestützte Teleskope eines Tricks behelfen: sie beobachten einen Nebeneffekt beim Eintreffen der Strahlung, die sogenannten Tscherenkow-Blitze. Mit zeitlich hochauflösenden Kameras lassen sich diese erkennen.
Das Cherenkov Telescope Array ist der Versuch, diese in den letzten Jahren auf La Palma prototypisch betriebenen Beobachtungstechnologien auf eine ganz neue Basis zu stellen. In der Atacama-Wüste soll in Zukunft ein riesiges Feld von drei unterschiedlichen Teleskopgrößen das All auf Gammastrahlenaktivität absuchen.
Dauer:
1 Stunde
33 Minuten
Aufnahme:
28.02.2022

Daniel Mazin |
Wir sprechen mit Daniel Mazin, dem technischer Projektleiter des Large-Sized Telescope (LST), das Teil des geplanten Cherenkov Telescope Array (CTA) ist. Daniel begleitet betreut sowohl die Entwicklung der prototypischen Teleskope auf La Palma als auch die Planung des großen, südlichen Teils des CTA in der Paranal-Region in der Atacama-Wüste in Chile. Daniel erläutert die physikalischen Hintergründe der Tscherenkow-Strahlung, die Funktionsweise der Gammateleskope und welche wissenschaftlichen Ziele und Perspektiven das CTA haben wird.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Cherenkov Telescope Array – Wikipedia
Pawel Alexejewitsch Tscherenkow – Wikipedia
Kosmische Strahlung – Wikipedia
Victor Franz Hess – Wikipedia
Ionisierende Strahlung – Wikipedia
Elektronenvolt – Wikipedia
Isotropie – Wikipedia
Gammastrahlung – Wikipedia
Elektromagnetische Welle – Wikipedia
Pion – Wikipedia
- Kosmische Strahlung erzeugt auch Gammastrahlung
Synchrotronstrahlung – Wikipedia
Compton-Effekt – Wikipedia
Alpha-Magnet-Spektrometer – Wikipedia
RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer | Raumzeit
Positron – Wikipedia
Supernova – Wikipedia
IceCube – Wikipedia
RZ073 IceCube Neutrino Observatory | Raumzeit
Fermi Gamma-ray Space Telescope – Wikipedia
High Energy Gamma Ray Astronomy – Wikipedia
MAGIC-Teleskope – Wikipedia
Mach-Zahl – Wikipedia
Tscherenkow-Blitz – Wikipedia
Photomultiplier – Wikipedia
Kathode – Wikipedia
Dynode – Wikipedia
Quantenausbeute – Wikipedia
Teilchenschauer – Wikipedia
Stereoskopie – Wikipedia
Zenit – Wikipedia
Pulsar – Wikipedia
Framework Programmes for Research and Technological Development - Wikipedia
Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur – Wikipedia
Paranal-Observatorium – Wikipedia
Europäische Südsternwarte – Wikipedia
Krebsnebel – Wikipedia
Standardkerze – Wikipedia
CERN – Wikipedia
Ringpuffer – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Lorentz-Transformation – Wikipedia
Dunkle Energie – Wikipedia
RZ103 Gran Telescopio Canarias
Aufbau und Betrieb des größten optischen Teleskops der Welt

Die Kanarische Insel La Palma beherbergt ist wie ihre Nachbarinsel Teneriffa Standort zahlreicher Teleskope. Die hohe Bergregion im Norden der Insel bietet für viele Anwendungen einen idealen Platz. Das auffälligste und bekannteste Teleskop ist das Gran Telescopio Canarias, dass seit gut einem Jahrzehnt das größe optische Teleskop der Welt ist.
Dauer:
1 Stunde
35 Minuten
Aufnahme:
27.02.2022

Stefan Geier |
Wir sprechen mit Stefan Geier, Support Astronomer am Gran Telescopio Canarias auf La Palma. Er ist zuständig für den Betrieb des Teleskops und arbeitet als Wissenschaftler für Wissenschaftler, in dem er die ordnungsgemäße Planung und Durchführung der beantragten Beobachtungen sicherstellt und unter Berücksichtigung verschiedener Beobachtungsparameter und Einflüsse durch die Natur die maximale Auslastung des Teleskops garantiert. Wir sprechen über den Geschichte, Aufbau und Struktur des Teleskops, den Ablauf der Beobachtungen und welche Faktoren über den Erfolg der wissenschaftlichen Arbeit entscheidend sind.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
RZ068 Bodengestützte Astronomie | Raumzeit
RZ094 Weltraumbeobachtung und die Wissenschaft | Raumzeit
Niels-Bohr-Institut – Wikipedia
Gran Telescopio Canarias – Wikipedia
Nordic Optical Telescope – Wikipedia
Thirty Meter Telescope – Wikipedia
Extremely Large Telescope – Wikipedia
Calima – Wikipedia
Extinktion (Optik) – Wikipedia
Azimut – Wikipedia
Very Large Telescope - Wikipedia
Cassegrain-Teleskop – Wikipedia
Ritchey-Chrétien-Cassegrain-Teleskop – Wikipedia
Nasmyth-Teleskop – Wikipedia
Licht – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Grantecan: OSIRIS
Grantecan: EMIR
Grantecan: MEGARA
Integral field spectrograph - Wikipedia
Doppler-Effekt – Wikipedia
Rotverschiebung – Wikipedia
Grantecan: CanariCam
Grantecan: HORuS
Grantecan: MIRADAS
Osiris – Wikipedia
Horus – Wikipedia
Megara – Wikipedia
Europäische Südsternwarte – Wikipedia
Seeing – Wikipedia
Halbwertsbreite – Wikipedia
Winkelsekunde – Wikipedia
Signal-Rausch-Verhältnis – Wikipedia
RZ102 Galaxien-Beobachtung
Auf der Jagd nach neuen Galaxien

Hunderte Millionen Sterne bevölkern unsere Galaxis und hunderte Millionen solcher Galaxien mit hunderten von Millionen Sternen sind jenseits Milchstraße im Universum zu entdecken. Die aktive Beobachtung dieser Galaxien dient dem Verständnis der Entstehung des Universums und damit auch unserer Galaxis und der Überprüfung physikalischer Theorien. Neben der reinen Katalogisieren dieser Galaxien ist aber vor allem die genaue Untersuchung ihrer Eigenschaften ein wichtiger Beitrag zur Astrophysik.
Dauer:
1 Stunde
39 Minuten
Aufnahme:
23.02.2022

Helmut Dannerbauer |
Helmut Dannerbauer ist der „Galaxienjäger“ beim Instituto Astrofisica de Canarias auf Teneriffa, er durchforstet das All nach Galaxien und entdeckt dabei komplett neue Systeme und untersucht bekannte Galaxien auf ihre Beschaffenheit.Wir sprechen über seine Arbeit, Vorgehensweise, Methoden und Werkzeuge.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Instituto de Astrofísica de Canarias – Wikipedia
Stephen Hawking – Wikipedia
Ludwig-Maximilians-Universität München – Wikipedia
Europäische Südsternwarte – Wikipedia
Reinhard Genzel – Wikipedia
Wechselwirkende Galaxien – Wikipedia
Max-Planck-Institut für Radioastronomie – Wikipedia
Santiago Ramón y Cajal – Wikipedia
RAMON Y CAJAL | EURAXESS
Tenure-Track – Wikipedia
RZ063 Galaxien und Kosmologie | Raumzeit
Balkenspiralgalaxie – Wikipedia
Elliptische Galaxie – Wikipedia
Irreguläre Galaxie – Wikipedia
Andromedagalaxie – Wikipedia
Magellansche Wolken – Wikipedia
Akkretionsscheibe – Wikipedia
Gezeitenschweif – Wikipedia
Antennen-Galaxien – Wikipedia
Linsenförmige Galaxie – Wikipedia
Gran Telescopio Canarias – Wikipedia
Nahinfrarotspektroskopie – Wikipedia
IRAM 30m telescope - Wikipedia
Kohlenstoffmonoxid – Wikipedia
Rotverschiebung – Wikipedia
Interferometer (Radioastronomie) – Wikipedia
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia
Northern Extended Millimeter Array - Wikipedia
Atacama Pathfinder Experiment – Wikipedia
La-Silla-Observatorium – Wikipedia
Galaxienhaufen – Wikipedia
MRC 1138-262 - Wikipedia
Virgo-Galaxienhaufen – Wikipedia
Coma-Galaxienhaufen – Wikipedia
Hubble Deep Field – Wikipedia
Starburstgalaxie – Wikipedia
Signal-Rausch-Verhältnis – Wikipedia
Flexible Image Transport System – Wikipedia
Arecibo-Observatorium – Wikipedia
Contact (1997) – Wikipedia
Scheinbare Helligkeit – Wikipedia
H-alpha – Wikipedia
Sombrerogalaxie – Wikipedia
Einsteinring – Wikipedia
Gravitationslinseneffekt – Wikipedia
Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Lokale Gruppe – Wikipedia
Filament (Kosmos) – Wikipedia
Hyperion (Superhaufen) – Wikipedia
Internationale Astronomische Union – Wikipedia
RZ101 Exoplaneten-Beobachtung
Die Beobachtung von Extrasolaren Planeten wechselt von der Entdeckungs- in die aktive Erforschungsphase
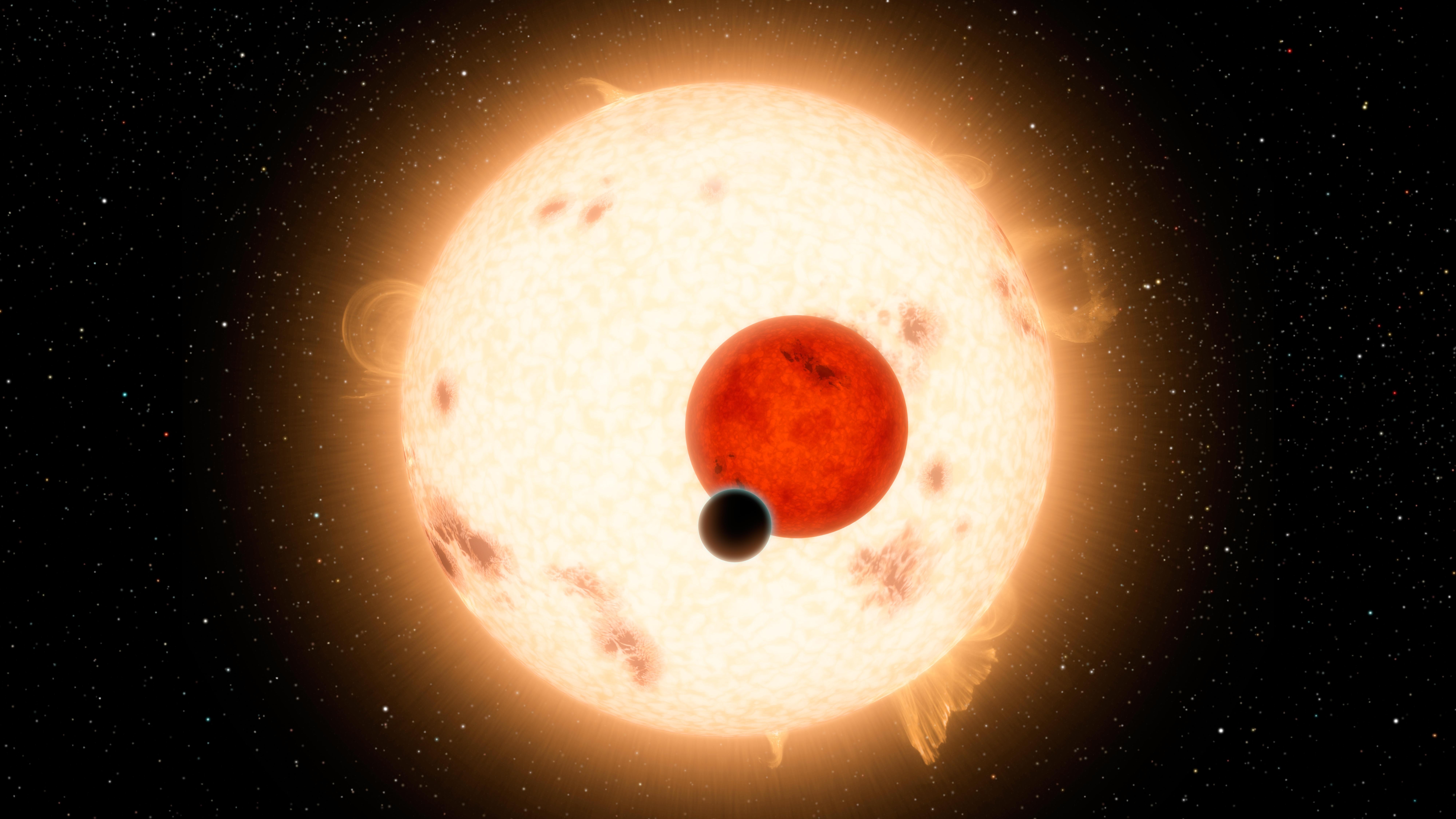
Es ist noch nicht so lange her und Exoplaneten waren eine fundamentale Neuigkeit und wichtige Entdeckung. Mit der Zeit ist aber die reine Entdeckung und Zählung dieser Objekte nicht mehr ausreichend: man rückt ihnen mit zahlreichen neuen Weltraumteleskopen auf die Pelle und gewinnt zunehmend neue Erkenntnisse über andere und letztlich auch unser eigenes Sonnensysteme.
Dauer:
1 Stunde
38 Minuten
Aufnahme:
22.02.2022

Hans Jörg Deeg |
Ich spreche mit Hans Jörg Deeg, Wissenschaftler am Instituto de Astrofísica de Canarias und Urgestein der Exoplanetenforschung. Wir sprechen über die etablierten Beobachtungsmethoden und Astroseismologiebei Exoplaneten, über die bekannten Planetentypen, die man bisher gefunden hat, die Ergebnisse bisheriger Missionen und die Techniken und Forschungsziele aktueller und kommender Weltraumteleskope. Zum Abschluss schauen wir noch auf ein paar skurille Sonnensysteme und erläutern, warum ein neunter Planet in unserem Sonnensystem oder auch ein Planet wie Tatooine aus Star Wars alles andere als unwahrscheinlich sind.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Wikipedia
University at Buffalo – Wikipedia
Very Large Array – Wikipedia
Transitmethode – Wikipedia
Zirkumbinärer Planet – Wikipedia
Instituto de Astrofísica de Canarias – Wikipedia
Dimidium – Wikipedia
Hot Jupiter – Wikipedia
Spektralklasse – Wikipedia
Habitable Zone – Wikipedia
Migration (Astronomie) – Wikipedia
HARPS-N - Wikipedia
Extremely Large Telescope – Wikipedia
HD 209458 – Wikipedia
COROT (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Ekliptik – Wikipedia
Transiting Exoplanet Survey Satellite – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
PLATO – Wikipedia
Asteroseismologie – Wikipedia
Darwin (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Tatooine - Wikipedia
Zirkumbinärer Planet – Wikipedia
Doppelstern – Wikipedia
Planet Neun – Wikipedia
RZ100 Raumzeit und Gravitation
Über das Wesen der Raumzeit die Suche nach einer Erklärung für Gravitation
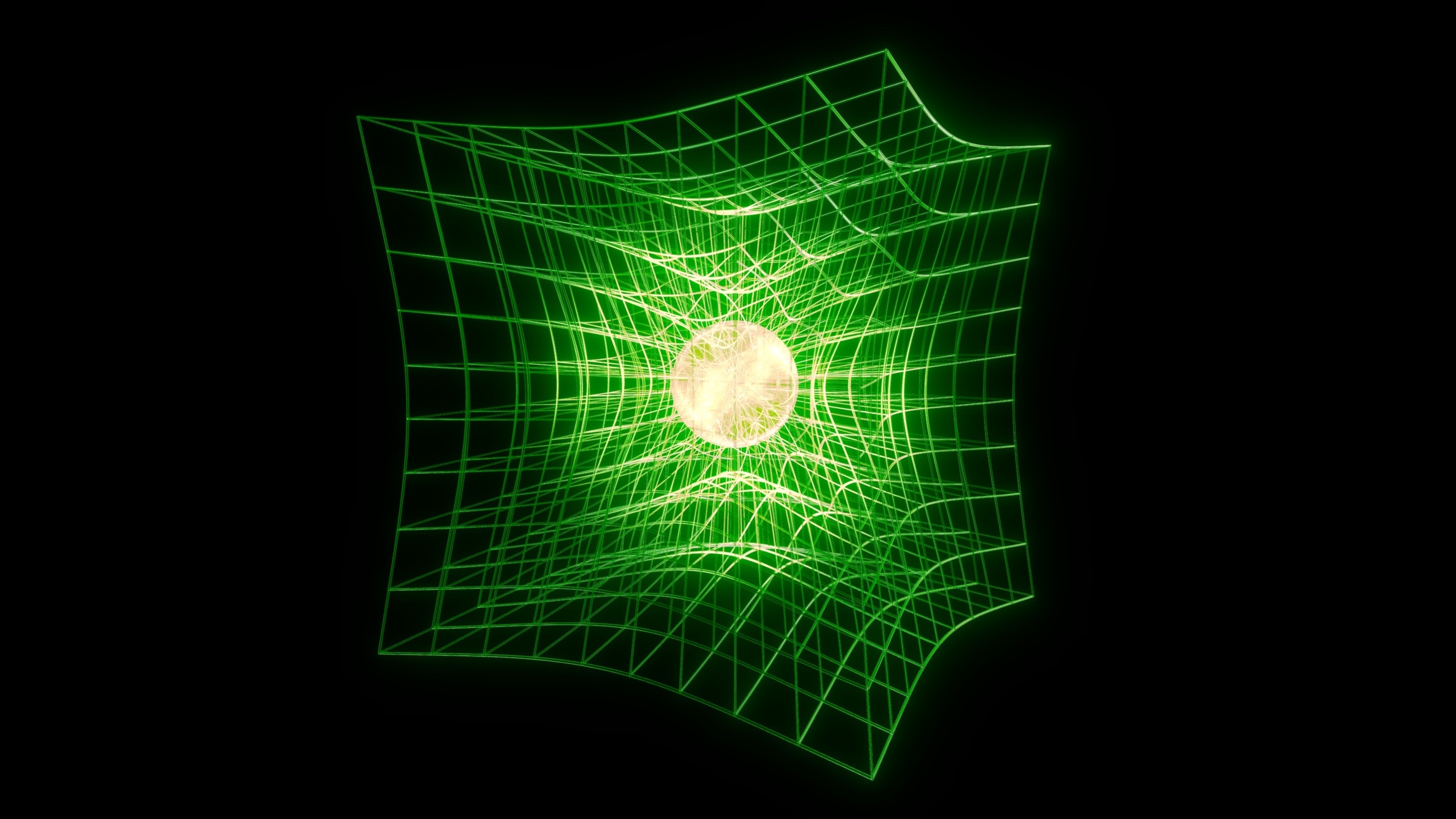
Newton und Einstein haben der Welt Formeln gegeben, die das Wesen unserer Welt und des Universums sehr akkurat und belastbar beschreiben. Sie haben uns den Zugang und die Nutzung des Alls eröffnet und viele Fragen über die Entstehung und Funktion des Weltalls beantwortet.
Doch noch mehr Fragen wurden aufgeworfen und bleiben vorerst unbeantwortet. Wir können das was, was wir erleben und nutzen gut mathematisch beschreiben, doch wissen wir auch, dass diese Beschreibungen ihre Grenzen haben. Diese zu durchschreiten ist eine Aufgabe der theoretischen Physik und Kosmologie, die auf der Suche ist nach einem noch besseren Verständnis dessen, was die Welt im innersten zusammenhält.
Dauer:
1 Stunde
35 Minuten
Aufnahme:
15.04.2022

Lavinia Heisenberg |
Wir sprechen mit Lavinia Heisenberg, theoretische Physikerin und Kosmologin an den Universitäten in Zürich und Heidelberg. Sie forscht an Modellen zur Beschreibung des Universums und erläutert, warum unser aktuelles Weltbild des Universums noch lange nicht auserzählt ist.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Isaac Newton – Wikipedia
Gravitation – Wikipedia
Newtonsches Gravitationsgesetz – Wikipedia
Axiom – Wikipedia
Raumzeit – Wikipedia
Differentialgeometrie – Wikipedia
Galilei-Transformation – Wikipedia
Lorentz-Transformation – Wikipedia
Inertialsystem – Wikipedia
Freier Fall – Wikipedia
Quant – Wikipedia
Maxwell-Gleichungen – Wikipedia
Photoelektrischer Effekt – Wikipedia
Quantenmechanik – Wikipedia
Quantenfeldtheorie – Wikipedia
Teilchenphysik – Wikipedia
Allgemeine Relativitätstheorie – Wikipedia
Minkowski-Raum – Wikipedia
Äther (Physik) – Wikipedia
Urknall – Wikipedia
Large Hadron Collider – Wikipedia
Schwarzes Loch – Wikipedia
Singularität (Astronomie) – Wikipedia
Dunkle Energie – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Hubble-Konstante – Wikipedia
Stringtheorie – Wikipedia
Vektorfeld – Wikipedia
Quantengravitation – Wikipedia
Kosmologie – Wikipedia
Gravitationswelle – Wikipedia
LIGO – Wikipedia
Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia
RZ099 CHEOPS
Ein schielendes Auge nimmt Exoplaneten ins Visier
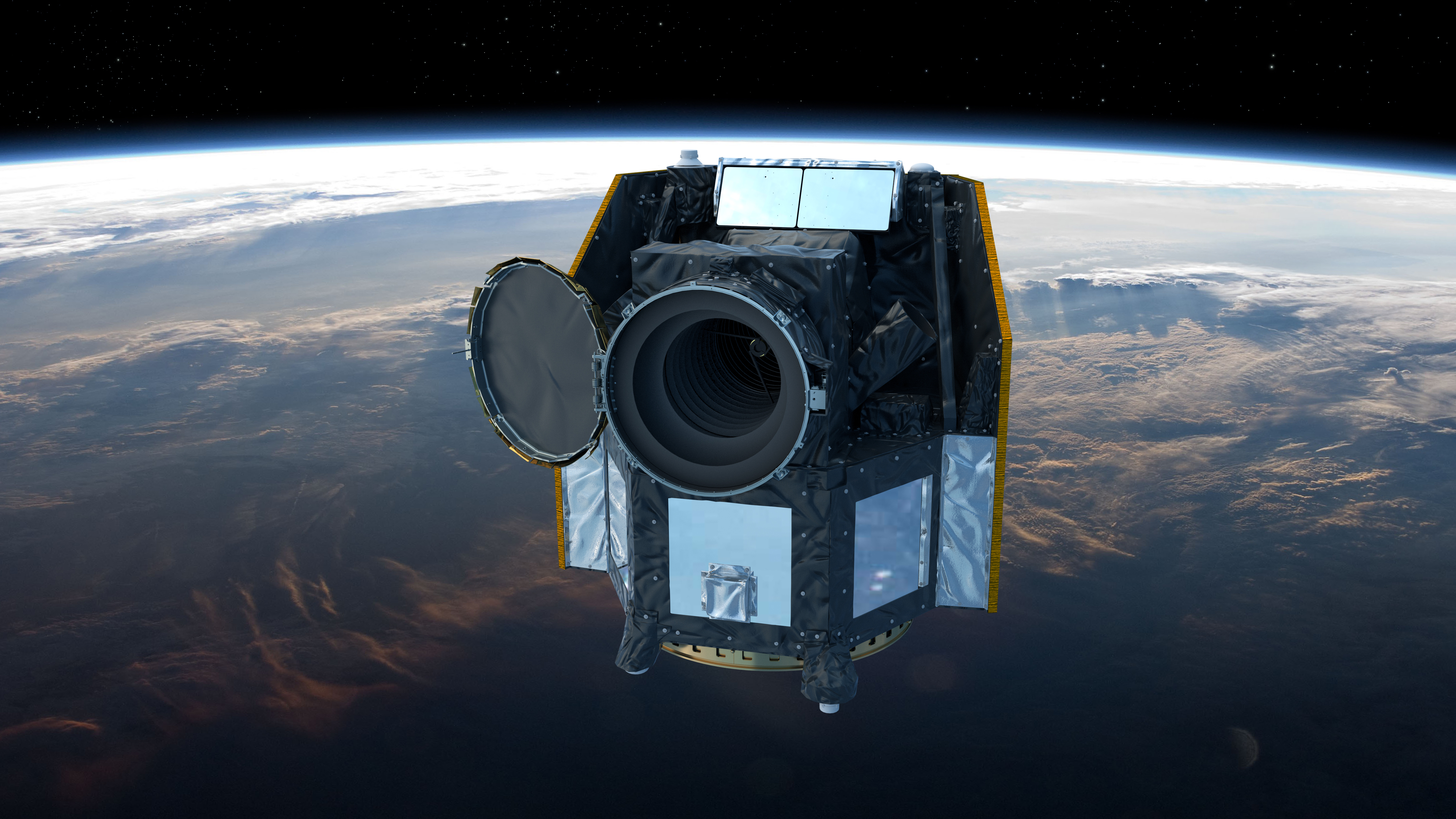
Weltraumteleskope versuchen alle möglichen Blickwinkel auf das All einzunehmen und spezialisieren sich dabei auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das Projekt CHEOPS ist dabei eine einfache und reduzierte und damit auch vergleichsweise günstige Mission, die in Kooperation mit der ESA von der Schweiz aus geleitet und gelenkt wird.
CHEOPS konzentriert sich darauf, die Helligkeit von Sternen und Exoplaneten mit einer außerordentlichen Auflösung und Genauigkeit über längere Zeit zu messen und dabei auch die feinsten Änderungen aufzuzeichnen
Dauer:
1 Stunde
33 Minuten
Aufnahme:
08.11.2021

Christopher Broeg |
Wir sprechen mit dem Project Manager von CHEOPS, Christopher Broeg vom Centre for Space and Habitability in Bern über die Entstehungsgeschichte der Mission, wie der kompakte Satellit entworfen und gebaut wurde, wie so eine kleine Mission ihren Launcher findet und wie das Instrument funktioniert und welche Ergebnisse es bereits geliefert hat.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
CHEOPS (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Exoplanet – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
COROT (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Transiting Exoplanet Survey Satellite – Wikipedia
Cosmic Vision 2015–2025 – Wikipedia
Parts per million – Wikipedia
Sonnensynchrone Umlaufbahn – Wikipedia
Sojus (Rakete) – Wikipedia
Fregat – Wikipedia
Launch and Early Orbit Phase – Wikipedia
Dunkelstrom – Wikipedia
Bias (Elektronik) – Wikipedia
Zerodur – Wikipedia
Südatlantische Anomalie – Wikipedia
Van-Allen-Gürtel – Wikipedia
RZ034 Space Situational Awareness | Raumzeit
RZ007 Weltraumschrott | Raumzeit
RZ092 Weltraumschrott-Bekämpfung | Raumzeit
RZ098 Geschichte der Europäischen Raumfahrt
Europas steiniger Weg zu einem der großen Mitspieler der Internationalen Raumfahrt
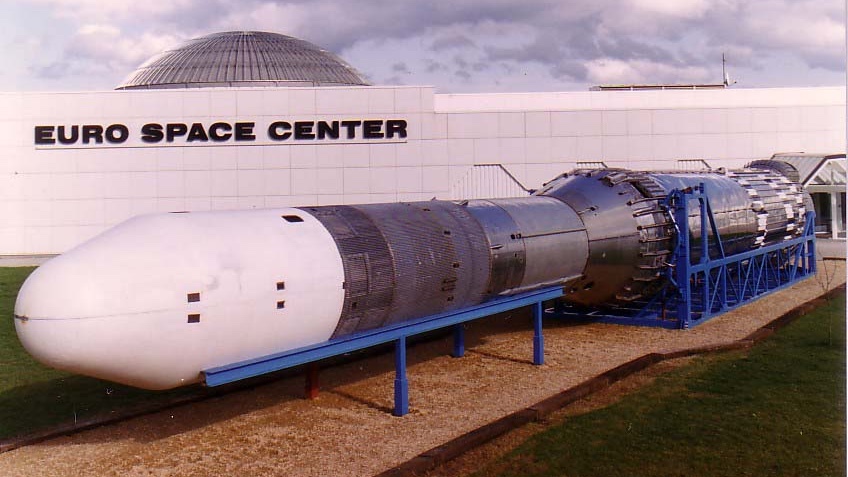
War Europa führend bei der Entwicklung der ersten Raketentechnik zu Beginn des 20. Jahrhunderts blutete sie in Folge des zweiten Weltkriegs nachhaltig aus und und brauchte ein paar Jahrzehnte, um die wieder auf die Füße zu kommen. Sinnbildlich für aber auch vorbildlich für den schwierigen Einigungsprozess Westeuropas fanden die großen europäischen Staaten nach einigen Mißerfolgen gegen Ende der Siebziger Jahre langsam zueinander und mit dem Erfolg des Ariane-Programms stieg auch die Bedeutung der Europäischen Raumfahrt im internationalen Vergleich und Wettbewerb stetig an. Heute ist die ESA und die europäische Raumfahrtindustrie die am besten vernetzte Wissensschaftsstruktur der Welt und trägt besonders mit seinen Erdbeobachtungsprojekten erheblich zur Gesamtleistung der Raumfahrt bei.
Dauer:
1 Stunde
43 Minuten
Aufnahme:
29.09.2021

Helmuth Trischler |
Wir sprechen mit dem Technikhistoriker und Museumsleiter für Forschung am Deutschen Museum in München Helmuth Trischler. Helmuth Trischler beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte der Raumfahrt. In dieser Rolle ist er auch aktiv in die historischen Forschung der ESA selbst mit eingebunden.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Deutsches Museum – Wikipedia
Raumfahrt - Deutsches Museum
Museum Mensch und Natur – Wikipedia
RZ086 Meteoriten | Raumzeit
Forschungsmuseum – Wikipedia
Frau im Mond – Wikipedia
Wernher von Braun – Wikipedia
Heereswaffenamt – Wikipedia
Heeresversuchsanstalt Peenemünde – Wikipedia
Aggregat 4 – Wikipedia
Vergeltungswaffe – Wikipedia
Von Braun: Dreamer of Space, Engineer of War | National Air and Space Museum
CERN – Wikipedia
Large Hadron Collider – Wikipedia
European Launcher Development Organisation – Wikipedia
European Space Research Organisation – Wikipedia
Apollo-Programm – Wikipedia
Sputnik – Wikipedia
Blue Streak – Wikipedia
Konrad Adenauer – Wikipedia
Georges Pompidou – Wikipedia
Woomera Prohibited Area – Wikipedia
Europa (Rakete) – Wikipedia
Europäische Weltraumorganisation – Wikipedia
Interkosmos – Wikipedia
Heinz Riesenhuber – Wikipedia
Reimar Lüst – Wikipedia
Helios (Sonde) – Wikipedia
Ludwig Erhard – Wikipedia
Lyndon B. Johnson – Wikipedia
Club of Rome – Wikipedia
Umweltbewegung – Wikipedia
Raumfahrtzentrum Guayana – Wikipedia
Ariane 5 – Wikipedia
Ariane 6 – Wikipedia
Sojus (Rakete) – Wikipedia
Glasnost – Wikipedia
Boeing – Wikipedia
Northrop Grumman – Wikipedia
Airbus – Wikipedia
Azur (Satellit) – Wikipedia
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Wikipedia
Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten – Wikipedia
Internationale Raumstation – Wikipedia
Japan Aerospace Exploration Agency – Wikipedia
Roskosmos – Wikipedia
Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia
Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) – Wikipedia
Anthropozän – Wikipedia
RZ097 Wettersatelliten
Die europäische Satellitenfamilie zur Messung der Wetterphänomene
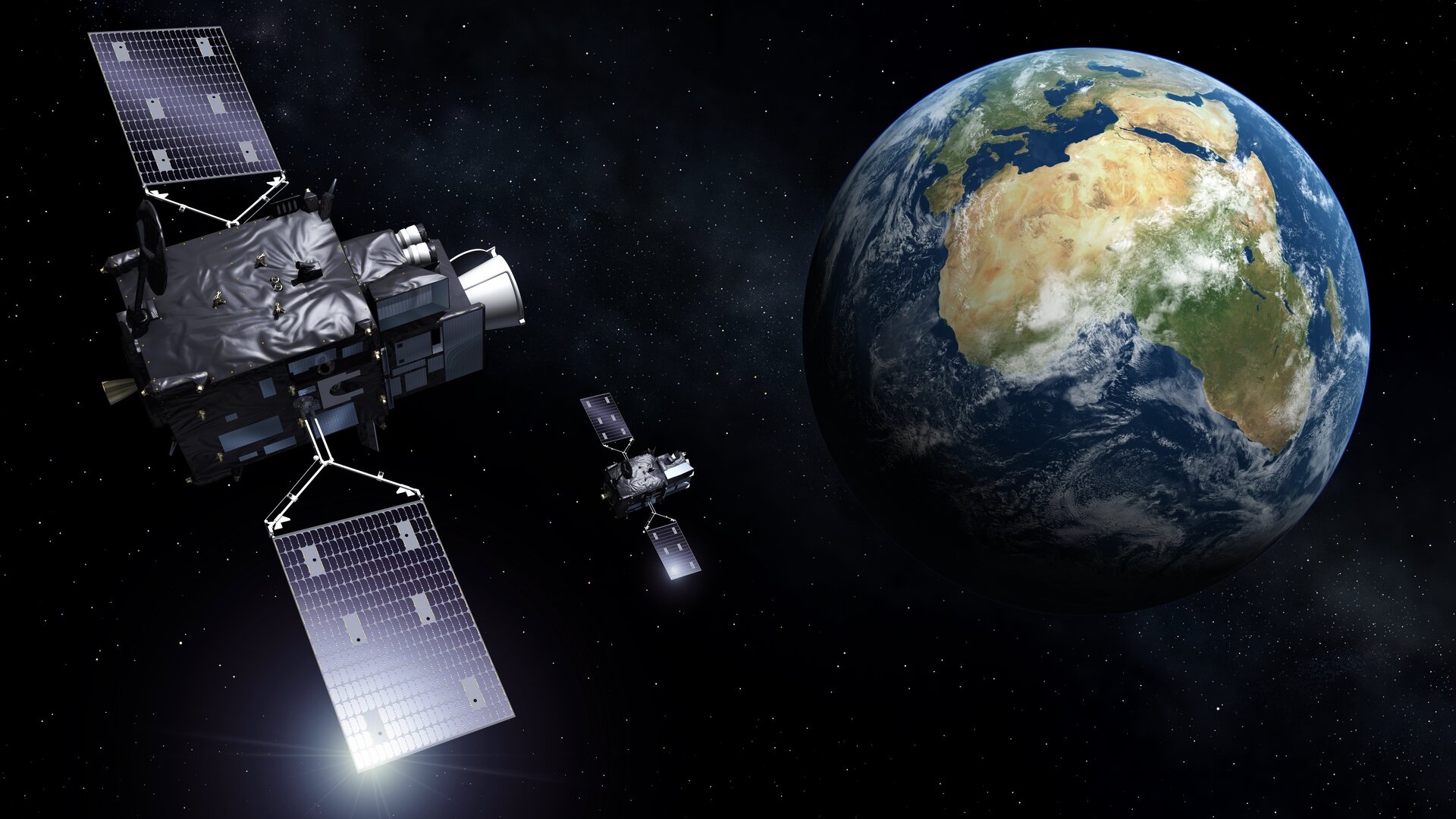
Die europäische Organisation EUMETSAT ist der europäische Betreiber von Wettersatelliten und Datendienstleister für die Wetterdienste und die Wissenschaft. EUMETSAT steuert von seinem Stammsitz in Darmstadt die Flotte der Meteosat- und MetOp-Satelliten und ist im Rahmen des EU-Programms Copernicus auch Teil der europäischen Erdbeobachtungsmissionen. Wir sprechen über die Entwicklung der europäischen Wettersatelliten seit den 70er Jahren und die die heutige Flotte von EUMETSAT zur Beobachtung der Wetterlage, wie neue Systeme geplant und schrittweise eingeführt werden und welche zukünftigen Herausforderungen für die Wetterbeobachtung anstehen.
Dauer:
1 Stunde
42 Minuten
Aufnahme:
28.09.2021

Cristian Bank |
Wir sprechen mit Cristian Bank, Direktor für die Entwicklung neuer Satellitensysteme bei EUMETSAT über die Entstehung des Meteosat-Programms und der Geburt der EUMETSAT-Organisation.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
EUMETSAT – Wikipedia
Voyager-Programm – Wikipedia
Viking – Wikipedia
Spacelab – Wikipedia
Space Shuttle – Wikipedia
Ernst Messerschmid – Wikipedia
Columbus (ISS-Modul) – Wikipedia
Ariane (Rakete) – Wikipedia
Automated Transfer Vehicle – Wikipedia
Wetterstation – Wikipedia
Wetterballon – Wikipedia
Höhenforschungsrakete – Wikipedia
Meteosat – Wikipedia
Geosynchrone Umlaufbahn – Wikipedia
Sonnensynchrone Umlaufbahn – Wikipedia
Sofortbildkamera – Wikipedia
Cirrus (Wolke) – Wikipedia
European Launcher Development Organisation – Wikipedia
European Space Research Organisation – Wikipedia
Flugmeteorologie – Wikipedia
CCD-Sensor – Wikipedia
Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia
Sojus (Rakete) – Wikipedia
Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 – Wikipedia
Sentinel (Satellit) – Wikipedia
Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) – Wikipedia
RZ069 Copernicus Open Data Strategy | Raumzeit
Cloud Computing – Wikipedia
Big Data – Wikipedia
Destination Earth (European Union) - Wikipedia
Satellite Application Facilities (SAFs) | EUMETSAT
Maschinelles Lernen – Wikipedia
Jason series | EUMETSAT
Jason satellite series - Wikipedia
CryoSat – Wikipedia
ADM-Aeolus – Wikipedia
RZ096 Erdähnliche Exoplaneten
Die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nimmt Fahrt auf

Exoplaneten sind eine der jüngsten wissenschaftlichen Disziplinen, doch beschleunigt sich die Zahl der Erkenntnisse durch zahlreiche erfolgreiche Deep Space Missionen und weiterer Forschung in diesem Bereich immer mehr. Nach der ersten Runde der reinen Detektion dieser fernen und schwer zu findenden Körper, geht jetzt auch die Suche nach Planeten los, die Gemeinsamkeiten mit der Erde aufweisen.
Dauer:
1 Stunde
39 Minuten
Aufnahme:
27.09.2021

Lena Noack |
Wir sprechen mit Lena Noack, Professorin und Leiterin der Gruppe Geodynamik und Mineralphysik planetarer Prozesse am Institut der Geowissenschaften der FU Berlin. Sie rückt den Exoplaneten auch mathematisch zu Leibe indem sie in komplexen Modellierungen die Entstehung kompletter Sonnensysteme simuliert um den letzten Geheimnissen der Exoplaneten auf den Leib zu rücken.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
RZ060 Extrasolare Planeten | Raumzeit
DLR - Institut für Planetenforschung - Home
- DLR Institut für Planetenforschung
Plattentektonik – Wikipedia
Vulkanismus – Wikipedia
Exoplanet – Wikipedia
COROT (Weltraumteleskop) – Wikipedia
PLATO – Wikipedia
Pulsar – Wikipedia
Interferometrie – Wikipedia
Large Interferometer For Exoplanets - Wikipedia
Transiting Exoplanet Survey Satellite – Wikipedia
Mars (Planet) – Wikipedia
Venus (Planet) – Wikipedia
Spektralklasse – Wikipedia
Transitmethode – Wikipedia
Trappist-1 – Wikipedia
Habitable Zone – Wikipedia
Proxima Centauri – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Eismond – Wikipedia
Io (Mond) – Wikipedia
Akkretionsscheibe – Wikipedia
Mantelkonvektion – Wikipedia
Python (Programmiersprache) – Wikipedia
Matlab – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
RZ093 Das James-Webb-Weltraumteleskop | Raumzeit
Cyanobakterien – Wikipedia
Proxima Centauri – Wikipedia
Supererde – Wikipedia
New Horizons – Wikipedia
Breakthrough Starshot – Wikipedia
Sonnensegel (Raumfahrt) – Wikipedia
Außerirdisches Leben – Wikipedia
Phosphane – Wikipedia
Methan – Wikipedia
RZ086 Meteoriten | Raumzeit
Wichtiger Hinweis der Metaebene
Ein wichtiger Zwischenruf aus der Metaebene
Die Metaebene gibt es nur, weil Ihr, die Hörerinnen und Hörer, sie finanziert. Es gibt keine Einnahmen aus Werbung und das soll auch so bleiben. Ganz wichtig sind die Daueraufträge, die viele von Euch eingerichtet haben. Nun ändert sich leider (ein weiteres Mal nach 2020) die Bankverbindung und ich bitte Euch, Eure Daueraufträge entsprechend abzuändern, sonst geht der Metaebene sehr bald das Geld aus. Die neue IBAN lautet DE85120400000028046100.
Dauer:
5 Minuten
Aufnahme:
27.10.2021
Inhaber: Tim Pritlove IBAN: DE85120400000028046100 BIC: COBADEFF
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
RZ095 JUICE
Die ESA-Mission zu den Eismonden des Jupiters
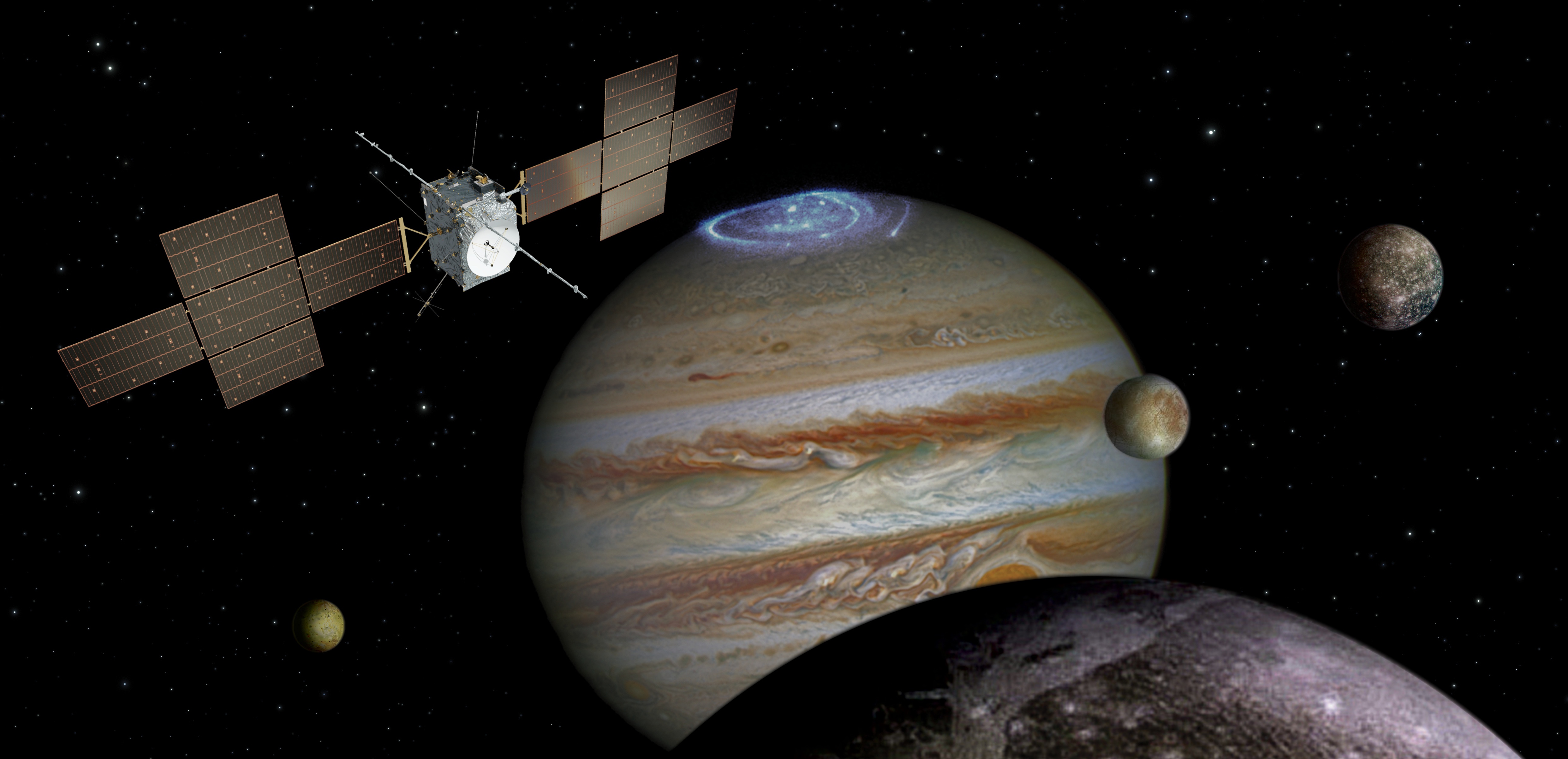
Das Jupitersystem mit seine großen Zahl an Monden birgt noch viel Unbekanntes und im nächsten Jahr startet die ESA mit JUICE eine Mission, die sich weniger auf den Planeten selbst als vielmehr auf seine Monde konzentrieren wird. Finales Ziel ist der größte der sogenannten Galileiischen Monde Ganymed. Die Sonde wird in einen Orbit um diesen Mond eintreten und dabei das Objekt über einen längeren Zeitpunkt mit vielen Instrumenten aufs genaueste untersuchen.
Dauer:
1 Stunde
7 Minuten
Aufnahme:
22.09.2021

Nicolas Altobelli |
Wir sprechen mit Nicolas Altobelli, Mission Manager der JUICE Mission am ESAC in Spanien. Wir reden über die Ziele der Mission, den langen Anflug auf das Jupitersystem und den Eintritt in den Orbit um Ganymed, die Instrumente der Sonde, wissenschaftlichen Ziele der Mission und die Besonderheiten und Rätsel, die uns die Monde des Jupiter heute noch aufgeben.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
JUICE (Raumsonde) – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
RZ020 Giotto und Rosetta | Raumzeit
RZ058 Philae | Raumzeit
Tschurjumow-Gerassimenko – Wikipedia
Cassini-Huygens – Wikipedia
Galileische Monde – Wikipedia
Galileo (Raumsonde) – Wikipedia
Raucher (Hydrothermie) – Wikipedia
Enceladus (Mond) – Wikipedia
Bahnresonanz – Wikipedia
Gasplanet – Wikipedia
Europa Clipper – Wikipedia
Juno (Raumsonde) – Wikipedia
Swing-by – Wikipedia
Ulysses (Sonde) – Wikipedia
Jupiter (Planet) – Wikipedia
RZ002 Missionsplanung | Raumzeit
RZ032 Das Saturnsystem | Raumzeit
Höhenmesser – Wikipedia
Deep Space Network – Wikipedia
Ariane 5 – Wikipedia
Europa (Mond) – Wikipedia
Enceladus (Mond) – Wikipedia
Polarlicht – Wikipedia
Wostoksee – Wikipedia
Habitable Zone – Wikipedia
Europa Clipper – Wikipedia
RZ094 Weltraumbeobachtung und die Wissenschaft
Planung und Koordination von Weltraumbeobachtungsmissionen beim Europäischen Astronomiezentrum (ESAC)

Zahlreiche Missionen der ESA sind der umfassenden astronomischen Beobachtung des Weltalls gewidmet. Gerade hat die Mission Gaia alle Erwartungen übererfüllt und einige neue Missionen wurden gerade gestartet oder stehen schon in den Startlöchern. Doch wie läuft so eine Mission im Vorfeld ab und wie gelingt die Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Community? Wir sprechen über diese Beobachtungsmissionen, das Wissenschaftsprogramm der ESA und auch die Zukunft der bodengestützen Astronomie durch das Extremely Large Telescope in Chile.
Dauer:
1 Stunde
28 Minuten
Aufnahme:
21.09.2021

Markus Kissler-Patig |
Wir sprechen mit Markus Kissler-Patig, Head of Science and Operations beim Europäischen Weltraumastronomiezentrum (ESAC) bei Madrid, Spanien. Er hat im Laufe seiner Karriere an zahlreichen Wirkungsstätten an Weltraumbeobachtungssystemen und -missionen teilgenommen und maßgeblich die Entwicklung des Extremely Large Telescope in Chile vorangetrieben.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Europäisches Weltraumastronomiezentrum – Wikipedia
Europäische Südsternwarte – Wikipedia
Extremely Large Telescope – Wikipedia
Gemini-Observatorium – Wikipedia
Astrobiologie – Wikipedia
Keck-Observatorium – Wikipedia
Very Large Telescope - Wikipedia
Gaia DR2 – Wikipedia
RZ076 Der Gaia-Sternkatalog | Raumzeit
Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia
PLATO – Wikipedia
Advanced Telescope for High Energy Astrophysics – Wikipedia
XMM-Newton – Wikipedia
Europäisches Raumflugkontrollzentrum – Wikipedia
Lagrange-Punkte – Wikipedia
Solar Orbiter – Wikipedia
ExoMars – Wikipedia
RZ051 XMM-Newton | Raumzeit
RZ052 Solar Orbiter | Raumzeit
JUICE (Raumsonde) – Wikipedia
Extremely Large Telescope – Wikipedia
Event Horizon Telescope – Wikipedia
RZ074 Schwarze Löcher | Raumzeit
RZ068 Bodengestützte Astronomie | Raumzeit
Europäische Südsternwarte – Wikipedia
RZ034 Space Situational Awareness | Raumzeit
RZ093 Das James-Webb-Weltraumteleskop
Die nächste Generation von Weltraumteleskopen wagt den Blick an den Rand des Universums
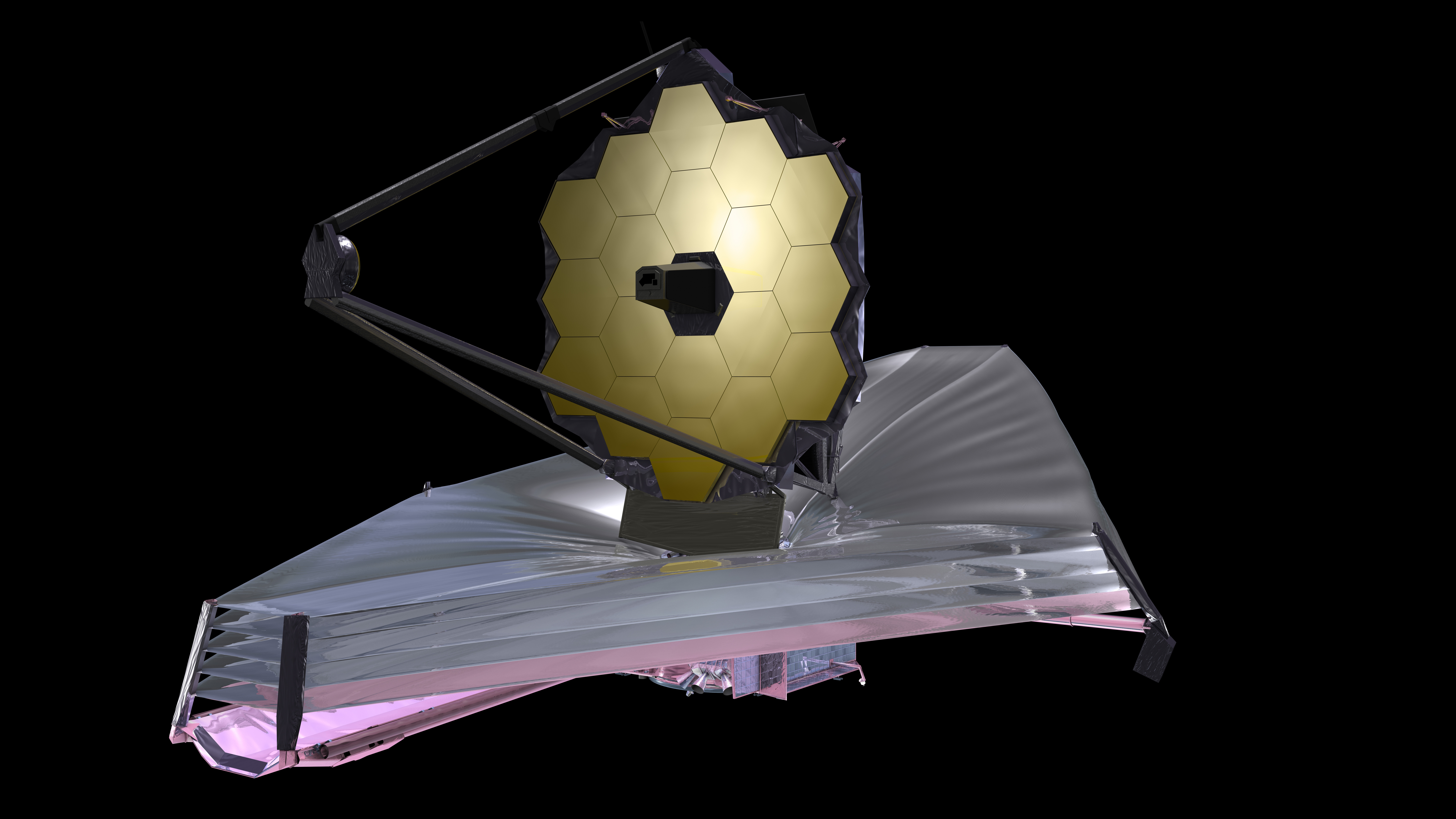
Das James-Webb-Weltraumteleskop ist wohl die international von der Astronomen, Astrophysikern und anderen Wissenschaftlern am meisten herbeigesehnte Mission seit Gaia. Denn das außergewöhnliche Teleskop, das vom Lagrange-Punkt L2 das Weltall beobachten soll stellt an Komplexität und Möglichkeiten der Instrumente alle bisherigen Projekte in den Schatten. Der Start hat sich schon um viele Jahre verzögert doch nun soll es im Dezember 2021 endlich so weit sein. Wenn alles klappt könnten sich eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben.
Dauer:
2 Stunden
1 Minute
Aufnahme:
21.09.2021

Günther Hasinger |
Wir sprechen mit Günther Hasinger, dem Leiter des Europäischen Weltraumastronomiezentrums (ESAC) der ESA bei Madrid über die Entstehungsgeschichte und die Anforderungen für die Mission, mit welchen Instrumenten das Teleskop ausgestattet ist und welche Erkenntnisse aus der Beobachtung des Alls mithilfe dieses leistungsstarken Instruments zu erwarten sind.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
- James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Europäisches Weltraumastronomiezentrum – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Supernova – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Joachim Trümper – Wikipedia — de.wikipedia.org
- RZ023 ROSAT | Raumzeit — Raumzeit
- ROSAT – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Schwarzes Loch – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Gleitsichtglas – Wikipedia — de.wikipedia.org
- XMM-Newton – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Chandra (Teleskop) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Kernfusion – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Gaia (Raumsonde) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- RZ076 Der Gaia-Sternkatalog | Raumzeit — Raumzeit
- Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Keck-Observatorium – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Hubble-Konstante – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Dunkle Energie – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Expansion des Universums – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Pan-STARRS – Wikipedia — de.wikipedia.org
- 1I/ʻOumuamua – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Rotverschiebung – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Infrarotstrahlung – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Exoplanet – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Mikrosystem (Technik) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Quasar – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Akkretionsscheibe – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Urknall – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Kaltgastriebwerk – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Trägheitsrad – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Lissajous-Figur – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Lagrange-Punkte – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Polyimide – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Ariane 5 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Atlas (Rakete) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Cosmic Evolution Survey - Wikipedia — en.wikipedia.org
- Hubble Deep Field – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Äther (Physik) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Hertzsprung-Russell-Diagramm – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Sternentstehung – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Planet Neun – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Michael E. Brown – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Hubble Pins Down Weird Exoplanet with Far-Flung Orbit | NASA — NASA
- Habitable Zone – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Roter Zwerg – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Trappist-1 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- CHEOPS (Weltraumteleskop) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Sonnenwind – Wikipedia — de.wikipedia.org
- ARIEL (Weltraumteleskop) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- PLATO – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Comet Interceptor – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Gammablitz – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Kilonova – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Laser Interferometer Space Antenna – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Periodensystem – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Nancy Grace Roman Space Telescope – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Large UV Optical Infrared Surveyor – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) — jpl.nasa.gov
- Cosmic Vision 2015–2025 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Voyage 2050 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Martian Moons Exploration – Wikipedia — de.wikipedia.org
- BepiColombo – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Advanced Telescope for High Energy Astrophysics – Wikipedia — de.wikipedia.org
- SMILE (Satellit) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- eROSITA – Wikipedia — de.wikipedia.org
RZ092 Weltraumschrott-Bekämpfung
Die Bekämpung des Weltraumschrotts im Erdorbit geht in seine nächste Phase
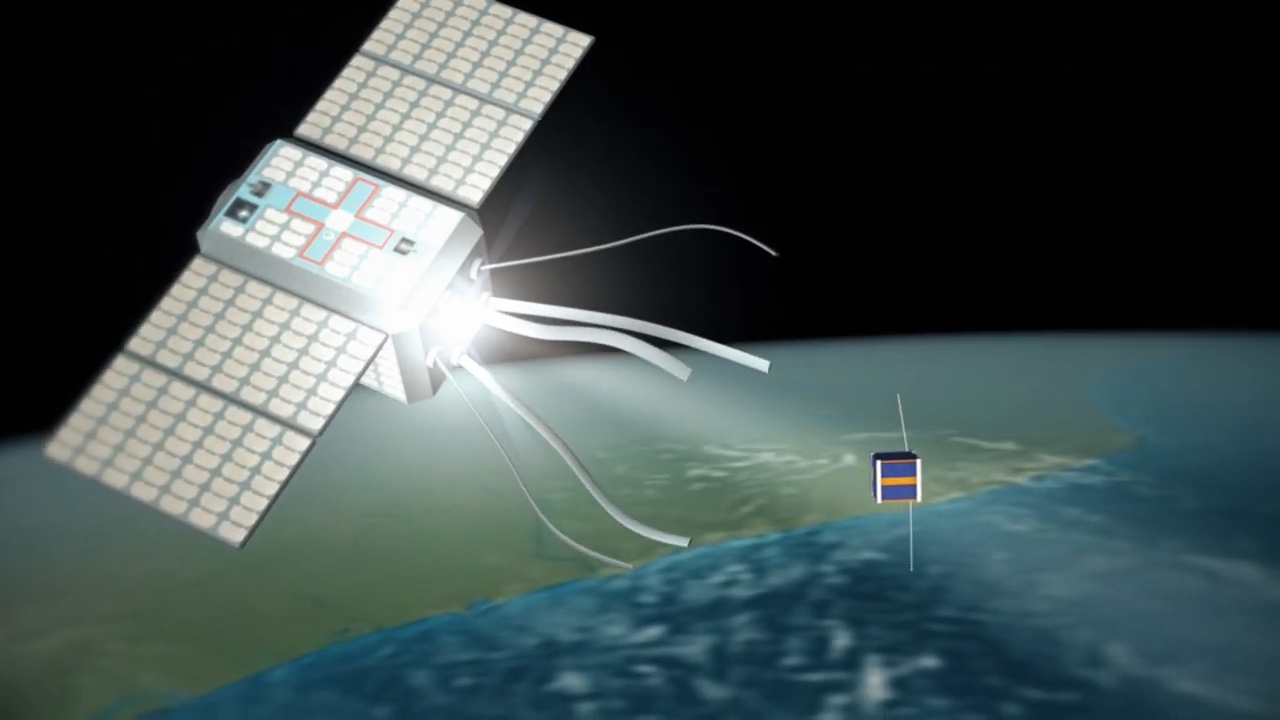
Weltraumschrott und auch der deutlich erhöhte Verkehr im Erdorbit stellen in zunehmenden Maße die Raumfahrt vor Probleme. Besonders die spürbar erhöhte Anzahl von Objekte durch viele neue Kleinsatelliten und Mega-Konstellationen wie Iridium, Starlink, OneWeb oder Kuiper vergrößern die Wahrscheinlichkeiten von neuen Kollisionen laufend.
Die ESA hat ihre Aktivitäten im Bereich der Bekämpfung des Schrotts ausgeweitet und verfolgt ein Space Safety Programm, dass mit neuen Radarsystemen die Erfassung der Objekte im Orbit deutlich verbessern soll und mit Lasertechnologie ggf. sogar die Bahnen von störenden Elementen vom Boden aus ändern kann. Projekte wie Clearspace One versuchen wiederum neue Missionen zu entwickeln, die aktiv besonders gefährliche Strukturen aus dem All zu fischen und zu einem kontrollierten Wiedereintritt zu bewegen.
Dauer:
1 Stunde
29 Minuten
Aufnahme:
26.10.2020

Holger Krag |
Wir sprechen mit Holger Krag vom Weltraumkontrollzentrum ESOC der ESA in Darmstadt. Holger war bereits vor gut zehn Jahren zu Gast bei Raumzeit und hat in der siebten Ausgabe dieser Gesprächsreihe von den spezifischen Problemen des Weltraumschrotts und ihrer möglichen Bekämpfung berichtet. Eine Dekade später blicken wir auf die damaligen Aussagen zurück und vergleichen, wie sich Raumfahrt und Problematik entwickelt haben und welche Hoffnung es gibt, dieser immer größer werdenden Gefahr Herr zu werden.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
RZ007 Weltraumschrott | Raumzeit
Mission Shakti - Wikipedia
Antisatellitenwaffe – Wikipedia
ESA - Space Debris
German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar – Wikipedia
RZ034 Space Situational Awareness | Raumzeit
Strahlungsdruck – Wikipedia
Voyager-Sonden – Wikipedia
Starlink – Wikipedia
OneWeb – Wikipedia
Projekt Kuiper – Wikipedia
Cubesat – Wikipedia
Satellitenorbit – Wikipedia
Envisat – Wikipedia
ESA - Clean Space
ClearSpace One - Wikipedia
Internationale Fernmeldeunion – Wikipedia
RZ091 Philosophie und das Universum
Philosophie als ordnende und Kraft der Naturwissenschaften
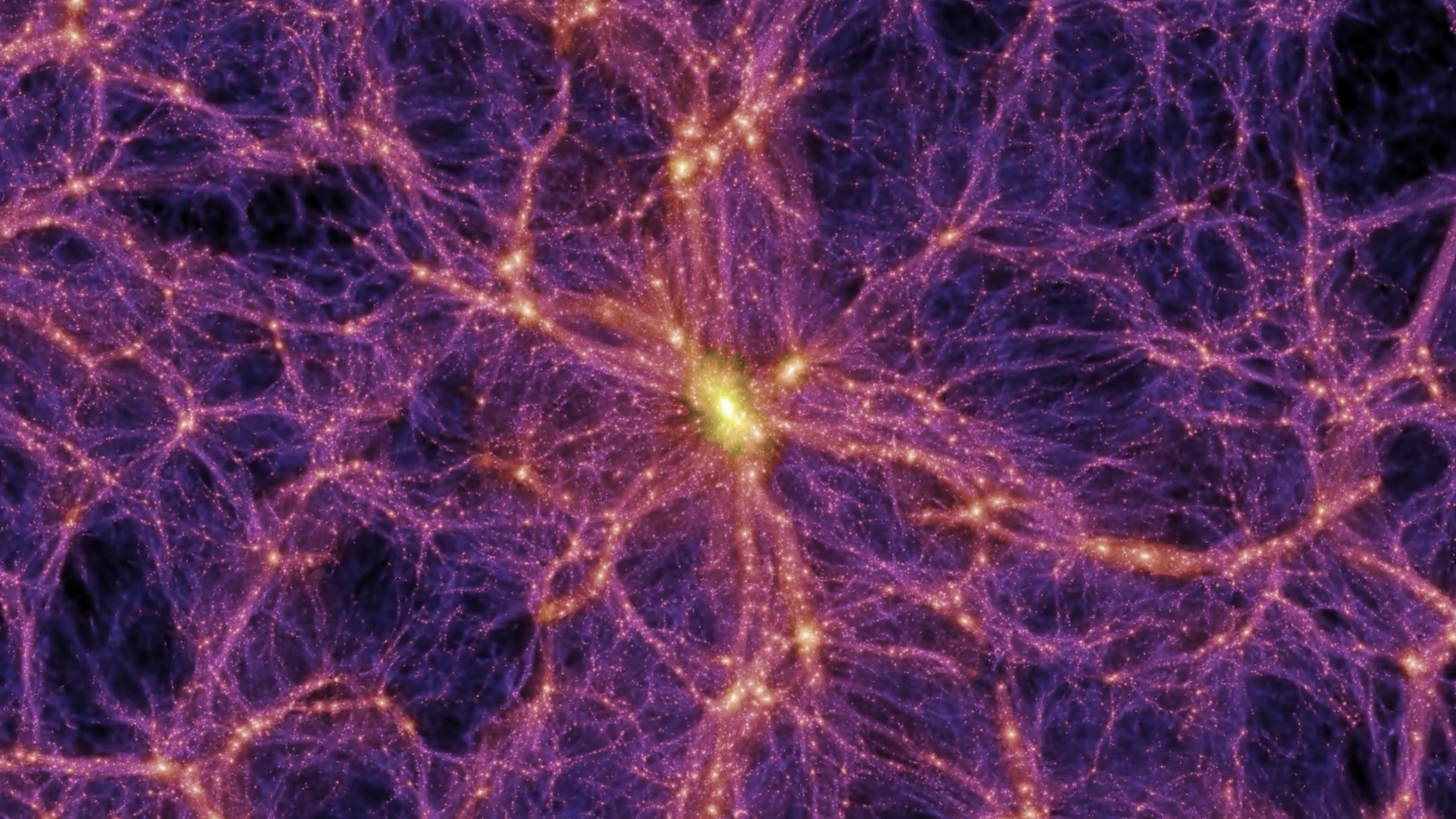
Philosophische Fragen scheinen nur auf den ersten Blick wenig vereinbar mit der Naturwissenschaft zu sein. Tatsächlich bietet die deutende und ordnende Kraft philosophischer Erklärungsmuster eine Menge Potential, auch in der Astrophysik und Astronomie bestimmte Fragestellungen neu zu formulieren oder zu vermitteln.
Dauer:
1 Stunde
59 Minuten
Aufnahme:
25.09.2020

Sibylle Anderl |
Sibylle Anderl hat sowohl Astrophysik als auch Philosophie studiert und ist heute als Wissenschaftsjournalistin tätig. In ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit als Astrophysikerin als auch in ihrer journalistischen Arbeit hat sie dabei die Prinzipien und die Methoden der Erkenntnisgewinnung aus der Philosophie in Einklang zu bringen und erläutert im Gespräch den potentiellen Nutzen eines wissenschaftstheoretischen Ansatzes für die Arbeit. Während die moderne Naturwissenschaft viele alte Vorstellungen der Welt durch die Philosophie abgelöst hat könnte umgekehrt die ordnende Kraft der Philosophie neue Ansätze für die Astrophysik liefern, wo die Erkenntnisse für Erklärungen noch nicht ausreichen.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Per Anhalter durch die Galaxis – Wikipedia
Technische Universität Berlin – Wikipedia
Europäische Südsternwarte – Wikipedia
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia
RZ068 Bodengestützte Astronomie | Raumzeit
Northern Extended Millimeter Array - Wikipedia
Heliosphäre – Wikipedia
Sherlock Holmes – Wikipedia
Aristoteles – Wikipedia
Mark Aurel – Wikipedia
Pulsar – Wikipedia
Jocelyn Bell Burnell – Wikipedia
Thomas S. Kuhn – Wikipedia
The Structure of Scientific Revolutions – Wikipedia
Astrobiologie – Wikipedia
Ontologie – Wikipedia
Physikalismus (Ontologie) – Wikipedia
Urknall – Wikipedia
Dunkle Energie – Wikipedia
Feld (Physik) – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Vera Rubin – Wikipedia
Struktur des Kosmos – Wikipedia
Gravitation – Wikipedia
Allgemeine Relativitätstheorie – Wikipedia
Quantenphysik – Wikipedia
Hawking-Strahlung – Wikipedia
Isaac Newton – Wikipedia
Trajektorie (Mathematik) – Wikipedia
Raumzeit – Wikipedia
Karl Popper – Wikipedia
Kurt Gödel – Wikipedia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wikipedia
Stringtheorie – Wikipedia
Stephen Hawking – Wikipedia
Richard Feynman – Wikipedia
Planckton - Blogs der FAZ
COVID-19-Pandemie – Wikipedia
Modell – Wikipedia
Interferometrie – Wikipedia
Mikrokosmos – Wikipedia
Elektron – Wikipedia
Quark (Physik) – Wikipedia
Das Universum und ich - Bücher - Hanser Literaturverlage
RZ090 Weltraumstaub
Kleinste Partikel des Alls entwickeln sich vom Hindernis zu einer neuen Form der Astronomie

Das gemeinhin als so leer angesehene Universum ist wenn man genauer hinschaut ziemlich staubig. Planetenstaub und interstellare Gase, Monderuptionen und die Ausgasungen von Kometen: überall künden kleinste Partikel von den Aktivitäten des Alls.
War es anfangs noch das Ziel, die Gefährdung der Raumfahrt durch diese Stäube besser einschätzen zu können hat sich diese Disziplin mit der Zeit zu einer neuartigen Form des Astronomie entwickelt. Künftig werden neue Missionen den Fluss der Partikel im All so genau berechnen können, dass sich heute noch verborgene Vorgänge und Spuren von unentdeckten Objekte auffinden lassen werden.
Dauer:
2 Stunden
11 Minuten
Aufnahme:
09.09.2020

Eberhard Grün |
Eberhard Grün hat Zeit seines wissenschaftlichen Lebens sich diesen Aspekten des Weltraums gewidmet und hat dabei zahlreiche Instrumente und Missionen entwickelt und mitgestaltet, mit dem sich der Weltraumstaub detektieren und vermessen ließ. Für seine Arbeit wurde er von der Royal Astronomical Society ausgezeichnet und auch ein Asteroid nach ihm benannt.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Eberhard Grün – Wikipedia
Zodiakallicht – Wikipedia
Giovanni Domenico Cassini – Wikipedia
Ekliptik – Wikipedia
Tonband – Wikipedia
Elektrostatik – Wikipedia
Olivingruppe – Wikipedia
Ion – Wikipedia
Plasma – Wikipedia
Koinzidenzmessung – Wikipedia
Höhenforschungsrakete – Wikipedia
European Space Research Organisation – Wikipedia
HEOS-1 – Wikipedia
Polarlicht – Wikipedia
Helios (Sonde) – Wikipedia
Saturn (Rakete) – Wikipedia
Mikrometeorit – Wikipedia
Neon – Wikipedia
Halleyscher Komet – Wikipedia
10P/Tempel 2 – Wikipedia
Giotto (Sonde) – Wikipedia
ISEE-3/ICE – Wikipedia
Kuipergürtel – Wikipedia
Tschurjumow-Gerassimenko – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
RZ020 Giotto und Rosetta | Raumzeit
RZ012 Sigmund Jähn | Raumzeit
STS-51-L – Wikipedia
Galileo (Raumsonde) – Wikipedia
Enceladus (Mond) – Wikipedia
Ulysses (Sonde) – Wikipedia
Swing-by – Wikipedia
Pioneer (Raumsonden-Programm) – Wikipedia
Jupiter (Planet) – Wikipedia
Io (Mond) – Wikipedia
rechtläufig und rückläufig – Wikipedia
Interstellarer Staub – Wikipedia
Cassini-Huygens – Wikipedia
Geysir – Wikipedia
RZ030 Cassini-Huygens | Raumzeit
Comet Rendezvous Asteroid Flyby - Wikipedia
Hayabusa 2 – Wikipedia
Stardust (Sonde) – Wikipedia
Surface Dust Analyser - Wikipedia
Destiny Plus – Wikipedia
(3200) Phaethon – Wikipedia
Geminiden – Wikipedia
Lagrange-Punkte – Wikipedia
(4240) Grün – Wikipedia
RZ089 Kerbal Space Program
Wie Missionsanalysten mit einem Spiel ihre eigene Arbeit besser kennenlernen

Es hat nicht lange gedauert und das vor einigen Jahren veröffentlichte Kerbal Space Program hat weltweit viele Freunde gefunden. Und dazu gehören auch viele, die selbst in der Raumfahrt arbeiten. Denn obwohl in dem Spiel nicht das tatsächliche Sonnensystem oder gar unser Universum modelliert wird, bildet es die physikalischen Gesetzmäßigkeiten korrekt ab und erlaubt es jedem, selbst Raketenprogramme aufzusetzen, Satelliten zu starten und im Orbit zu halten, Landemissionen auf anderen Planeten anzuführen und alle diese Raumfahrzeuge zusammen arbeiten zu lassen.
Dauer:
1 Stunde
36 Minuten
Aufnahme:
08.09.2020

Bruno Teixera de Sousa |
Bruno Teixera de Sousa ist Teamleiter für die Cluster II Mission der ESA und arbeitet am Europäischen Weltraumkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt. Doch neben seiner Hauptmission fährt er in der Freizeit noch zahlreiche Missionen im Kerbal Space Program und setzt die Software zum Beispiel auch ein, um Schüler auf Praktikum in die Welt der Missionsanalyse und -kontrolle einzuführen. Denn obwohl Kerbal eine ganz eigene Welt zeichnet sind die Lehren nahezu uneingeschränkt in die professionelle Raumfahrzeug-Steuerung zu übertragen und so schärfen auch die Profis ihre Fähigkeiten mit der Software.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Kerbal Space Program – Wikipedia
Battlestar Galactica – Wikipedia
Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel – Wikipedia
Venus Express – Wikipedia
RZ046 Venus Express | Raumzeit
Solar Orbiter – Wikipedia
RZ052 Solar Orbiter | Raumzeit
RZ011 Astronautenausbildung | Raumzeit
ESA Science & Technology - Cluster
Koronaler Massenauswurf – Wikipedia
RZ085 Erforschung der Sonne | Raumzeit
xkcd: Orbital Mechanics
Kerbol/de - Kerbal Space Program Wiki
Duna/de - Kerbal Space Program Wiki
Eve/de - Kerbal Space Program Wiki
RZ043 BepiColombo | Raumzeit
RZ083 SpaceX | Raumzeit
Swing-by – Wikipedia
ShadowZone - YouTube
RZ088 GEO600
Über die Technologie zur Detektion von Gravitationswellen

Unter dem unscheinbaren Namen GEO600 versteckt sich auf einem Feld in der Nähe von Hannover eine ebenso unscheinbare Anlage, die aber einen großen Einfluss auf die Forschung an Gravationswellen hat. Denn dort wird die Technologie, die weltweit in den Gravitationswellendetektoren zum Einsatz kommt maßgeblich mitentwickelt und vorangetrieben.
Gravitationswellen wurden 2016 in das Licht der Öffentlichkeit gehoben, nachdem mit den LIGO-Detektoren in den USA das erste Signal empfangen werden konnte. Die LIGO-Detektoren waren kurz vorher mit der neuesten Technik, die am GEO600 getestet wurde, ausgestattet worden. Und für die Zukunft werden weitere Maßnahmen erwogen, um die Erkennung der Gravitationswellen noch weiter zu verfeinern und damit das Zeitalter der Gravitationswellenastronomie einzuläuten.
Dauer:
2 Stunden
38 Minuten
Aufnahme:
03.07.2020

Harald Lück |
Ich spreche mit Harald Lück, dem Forschungsgruppenleiter für Laserinterferometrie & Gravitationswellen-Astronomie des Albert-Einstein-Instituts (bzw. Max-Planck-Instititut für Gravitationsphysik) in Hannover über den Aufbau von GEO600, welche technischen Herausforderungen gemeistert werden musste, um einen funktionierenden Detektor von Gravitationswellen zu entwickeln und zu betreiben.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
- Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Albert Einstein – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Gravitationswelle – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Raumzeit – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Joseph Weber (Physiker) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Neutronenstern – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Schwarzes Loch – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Kelvin – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Interferometrie – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Rainer Weiss - Wikipedia — en.wikipedia.org
- Laser – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Michelson-Interferometer – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Albert Abraham Michelson – Wikipedia — de.wikipedia.org
- GEO600 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- LIGO – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Russell Hulse – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Joseph Hooton Taylor, Jr. – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Pulsar – Wikipedia — de.wikipedia.org
- PSR 1913+16 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Akkretionsscheibe – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Rammelsberg – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Supernova – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Neutrino – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Beteigeuze – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Quadrupol – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Dipol – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Argon-Ionen-Laser – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Nd:YAG-Laser – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Optischer Resonator – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Moden – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Edelstahl – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Parts per million – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Quarzglas – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Dielektrikum – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Siliciumdioxid – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Tantal(V)-oxid – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Resonanzfrequenz – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Amplitude – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Fluktuations-Dissipations-Theorem – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Wärmerauschen – Wikipedia — de.wikipedia.org
- KAGRA – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Phasenmodulation – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Photodiode – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Photon – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Quantenmechanik – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Schrotrauschen – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Elektrisches Feld – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Fabry-Pérot-Interferometer – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Vakuumfluktuation – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Gequetschtes Licht – Wikipedia — de.wikipedia.org
- GW170817 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Einstein-Teleskop – Wikipedia — de.wikipedia.org
- National Institute of Standards and Technology – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Dunkle Materie – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Urknall – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Laser Interferometer Space Antenna – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Weißer Zwerg – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Europäisches Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen – Wikipedia — de.wikipedia.org
RZ087 Amateurastronomie
Selber in die Sterne schauen und dabei die Wissenschaft unterstützen

Astronomie ist kein Tätigkeitsfeld, das nur ausgebildeten Astronomen offen steht. Leistungsfähige Teleskope und Kameras sind schon lange in hoher Qualität in zunehmend erschwinglichen Preisklassen erhältlich und rund um die Welt werfen viele Sternenliebhaber ihren ganz privaten Blick ins Universum. Dabei steht bei vielen der Spaß an der Sache im Vordergrund, doch gibt es auch einige, die mit ihren Beoabachtungen auch die professionelle Sternenwissenschaft unterstützen oder sogar ihre eigenen Entdeckungen machen. Das Internet und frei verfügbare Software zur spezifisch auf Astronomie ausgerichteten Bildbearbeitung tun ihr übriges, diese Aktivitäten möglich zu machen.
Doch für die Hobbyastronomen wird es auch zunehmend schwieriger an der Lichtverschmutzung der menschlichen Zivilisation vorbei einen hochwertigen Blick auf die Sterne zu erhaschen. Viele mischen sich daher auch in die lokale Politik ein und drängen die Entscheidungsträger zu einem gewissenhafteren Einsatz von Nachtlicht bis hin zur Deklaration ganzer Landstriche zu Sternenparks. Bleibt die zunehmende Population des Firmaments durch immer neue Satelliten, die auch die Profis vor Probleme stellen.
Dauer:
1 Stunde
40 Minuten
Aufnahme:
17.03.2020

Carolin Liefke |
Carolin Liefke arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Haus der Astronomie, einem Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit und Didaktik der Astronomie auf dem Campus des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg.
Das Haus der Astronomie stellt Lehrkräften in Universitäten, Schulen oder auch Kindergärten Materialien für den Unterricht von Astronomie und Astrophysik bereit, führt Kurse für Lehrerinnen und Schüler an und unterstützt generell die Vermittlung des Wissens über das Universum.
Wir sprechen über die Möglichkeiten der Amateurastronomie, welche Technik und Software zum Einsatz gebracht werden kann und wie Probleme der übermäßigen Beleuchtung der Städte und Siedlungen bekämpft werden können.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Shoemaker-Levy 9 – Wikipedia
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Haus der Astronomie – Wikipedia
Dobson-Teleskop – Wikipedia
Newtonteleskop – Wikipedia
Andromedagalaxie – Wikipedia
Okular – Wikipedia
Radioteleskop Effelsberg – Wikipedia
Gezeitenschweif – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Supernova – Wikipedia
Palomar Transient Factory - Wikipedia
Beteigeuze – Wikipedia
SkySafari 6
Stellarium Astronomy Software
PixInsight — Pleiades Astrophoto
Fitswork - Bildverarbeitung für Astrofotografien
DeepSkyStacker
AutoStakkert! – Lucky Imaging with an Edge
FireCapture
Astrometrica
Lichtverschmutzung – Wikipedia
Lichtschutzgebiet – Wikipedia
Mojave-Wüste – Wikipedia
Andromedagalaxie – Wikipedia
Starlink – Wikipedia
Vantablack – Wikipedia
Elon Musk – Wikipedia
RZ086 Meteoriten
Was uns Meteoriten über das Universum verraten

Das Sonnensystem ist mit unzähligen Asteroiden, Kometen und anderen Bruchstücken durchsetzt und wie es der Zufall so werden diese zu Meteroiden, die die Erde ansteuern und dann zu Meteoren, die flammend unsere Atmosphäre durchschneiden um am Ende als Meterorit auf der Erdoberfläche aufzuschlagen und für uns Zeuge einer kosmischen Vergangenheit werden, über die wir immer noch zu wenig wissen.
Doch schon heute können wir aus diesen zumeist schwarzen Körpern eine Menge herauslesen und teilweise auch ihre Herkunft bestimmen. In umfangreichen Sammlungen dieser Meteoriten lassen sich für die Raumfahrt gezielt bestimmte Objekte heraussuchen, um Aufschluss über die Beschaffenheit von Asteroiden zu erhalten, die von Raumfahrzeugen bereist werden. Eine solche Sammlung hält unter anderem das Museum für Naturkunde in Berlin vor und ist damit Partner der Raumfahrt und Wissenschaft.
Dauer:
1 Stunde
50 Minuten
Aufnahme:
10.03.2020

Ansgar Greshake |
Wir sprechen in dieser Ausgabe mit Ansgar Greshake, dem Kustus (Kurator) dieser Meteoritensammlung im Naturkundemuseum Wir sprechen über die Bedeutung dieser Sammlung und wie die wissenschaftliche Kooperation abläuft, woher die Sammlung ihre Meteoriten bezieht und wie das Museum sich diese Objekte auch mal von Dächern fegt.
Wir diskutieren ausführlich die Beschaffenheit und Bestandteile einzelner Meteroritenformen und was sie uns über das Universum erzählen, welches großes Interesse die Raumfahrt an diesen Steinen hat und auf welchen Orten der Welt es sich lohnt, nach schwarzen Steinen Ausschau zu halten.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Museum für Naturkunde (Berlin) – Wikipedia
Humboldt-Universität zu Berlin – Wikipedia
Meteorit – Wikipedia
Wüste – Wikipedia
Sahara – Wikipedia
Antarktis – Wikipedia
Tundra – Wikipedia
Nullarbor-Ebene – Wikipedia
Atacama-Wüste – Wikipedia
Namib – Wikipedia
Meteor von Tscheljabinsk – Wikipedia
Neuschwanstein (Meteorit) – Wikipedia
Schatzregal – Wikipedia
Himmelsscheibe von Nebra – Wikipedia
Nördlinger Ries – Wikipedia
Meteoroid – Wikipedia
Lockheed U-2 – Wikipedia
Ein Hobbyforscher sammelt winzige Meteoriten aus dem Staub der Städte - und verblüfft die Wissenschaft
Google Maps: IKEA Tempelhof Berlin
Citizen Science – Wikipedia
Eisen – Wikipedia
Komet – Wikipedia
Leoniden (Meteorstrom) – Wikipedia
Geminiden – Wikipedia
Eisenerz – Wikipedia
Windkanter – Wikipedia
Hayabusa 2 – Wikipedia
OSIRIS-REx – Wikipedia
(162173) Ryugu – Wikipedia
Yamato 691 - Wikipedia
Interstellares Medium – Wikipedia
Siliciumcarbid – Wikipedia
Steinmeteorit – Wikipedia
Olivingruppe – Wikipedia
Pyroxengruppe – Wikipedia
Tonminerale – Wikipedia
Aluminium – Wikipedia
Isotop – Wikipedia
Differenzierung (Planetologie) – Wikipedia
(4) Vesta – Wikipedia
Dawn (Raumsonde) – Wikipedia
(1) Ceres – Wikipedia
Sonnennebel – Wikipedia
Eisenmeteorit – Wikipedia
Eisen – Wikipedia
Nickel – Wikipedia
Taenit – Wikipedia
Kamacit – Wikipedia
Widmanstätten-Struktur – Wikipedia
Hoba (Meteorit) – Wikipedia
Stein-Eisen-Meteorit – Wikipedia
Peter Simon Pallas – Wikipedia
Krasnojarsk (Meteorit) – Wikipedia
Ensisheim (Meteorit) – Wikipedia
Phobos (Mond) – Wikipedia
Deimos (Mond) – Wikipedia
Japan Aerospace Exploration Agency – Wikipedia
Astrobiologie – Wikipedia
Organische Chemie – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Aminosäuren – Wikipedia
Alkohole – Wikipedia
Ketone – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
Tschurjumow-Gerassimenko – Wikipedia
Apollo-Programm – Wikipedia
Luna-Programm – Wikipedia
Mondmeteorit – Wikipedia
Einschlagkrater – Wikipedia
Basalt – Wikipedia
Erdkruste – Wikipedia
Erdmantel – Wikipedia
Ringwoodit – Wikipedia
Wadsleyit – Wikipedia
Feldspat – Wikipedia
Calcium – Wikipedia
International Mineralogical Association – Wikipedia
Viking – Wikipedia
Olympus Mons – Wikipedia
Mariner – Wikipedia
BepiColombo – Wikipedia
Feuerkugelnetz – Wikipedia
Tunguska-Ereignis – Wikipedia
2008 TC3 – Wikipedia
Starlink – Wikipedia
Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (1971) – Wikipedia
RZ085 Erforschung der Sonne
Die Erforschung von Sonnenwind und Magnetosphäre durch neue Missionen
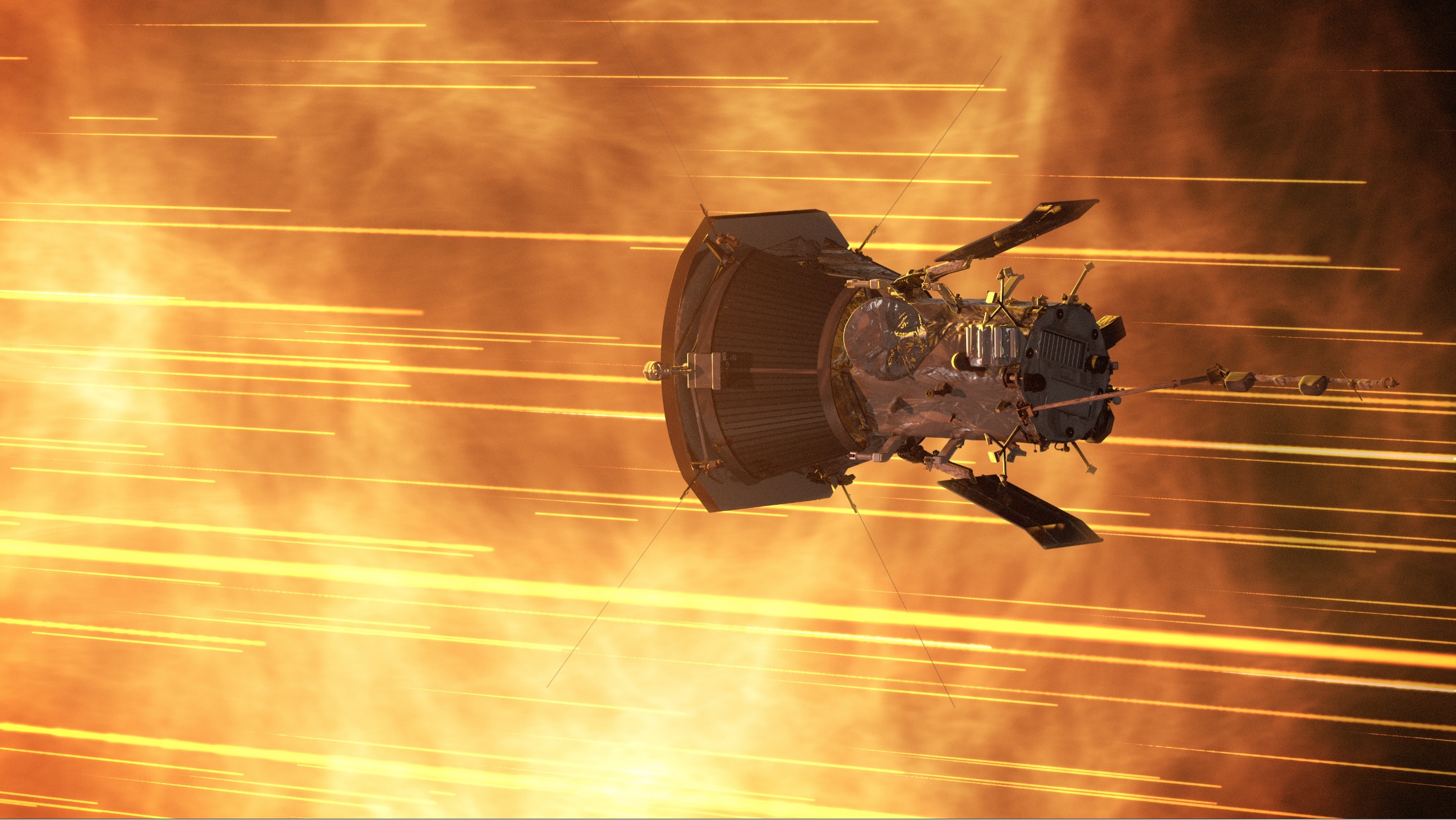
Die Sonne lag und liegt im Fokus diverser Missionen der letzten Jahrzehnte. Jetzt wird mit dem Doppelgespann Parker Solar Probe und dem Solar Orbiter ein weiterer und weitgehender Schritt unternommen, die letzten Rätsel der Sonne, ihrer Aktivität, des Sonnenwinds und einiger noch ungeklärter Phänomene zu lösen. Parker Solar Probe kommt dabei der Sonne so nah wie noch nie ein anderes Raumfahrzeug zuvor.
Dauer:
1 Stunde
55 Minuten
Aufnahme:
19.02.2020

Volker Bothmer |
Wir sprechen mit Volker Bothmer vom Institut für Astrophysik an der Georg-August-Universität in Göttingen. Er ist der Leiter der Arbeitsgruppe zur Physik der Sonne, Heliosphäre und des Weltraumwetters.
Volker Bothmer hat in den letzten Jahrzehnten an nahezu allen wichtigen Missionen mitgearbeitet und ist auch jetzt bei Parker Solar Probe und Solar Orbiter aktiv eingebunden.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Apollo 11 – Wikipedia
Magnetischer Sturm – Wikipedia
Sonnenfleck – Wikipedia
Helios (Sonde) – Wikipedia
Eugene N. Parker – Wikipedia
Ludwig Biermann – Wikipedia
Mariner – Wikipedia
Carl Friedrich Gauß – Wikipedia
Alexander von Humboldt – Wikipedia
Fluiddynamik – Wikipedia
Polarlicht – Wikipedia
Rudolf Wolf (Astronom) – Wikipedia
Richard Christopher Carrington – Wikipedia
Carrington-Ereignis – Wikipedia
Maxwell-Gleichungen – Wikipedia
Zeeman-Effekt – Wikipedia
Korona (Sonne) – Wikipedia
Photosphäre – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Heliosphäre – Wikipedia
Helioseismologie – Wikipedia
Ulysses (Sonde) – Wikipedia
Weltraumwetter – Wikipedia
STEREO – Wikipedia
Parker Solar Probe
Solar Orbiter
Lagrange-Punkte – Wikipedia
Solar Dynamics Observatory – Wikipedia
Swing-by – Wikipedia
Delta IV – Wikipedia
Zodiakallicht – Wikipedia
Atlas V – Wikipedia
Sublimation (Phasenübergang) – Wikipedia
Global Positioning System – Wikipedia
Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia
Deep Space Climate Observatory – Wikipedia
Advanced Composition Explorer – Wikipedia
RZ084 Besuch beim Asteroiden
Die Mission Hayabusa 2 und der Lander MASCOT besuchen den Asteroiden Ryugu
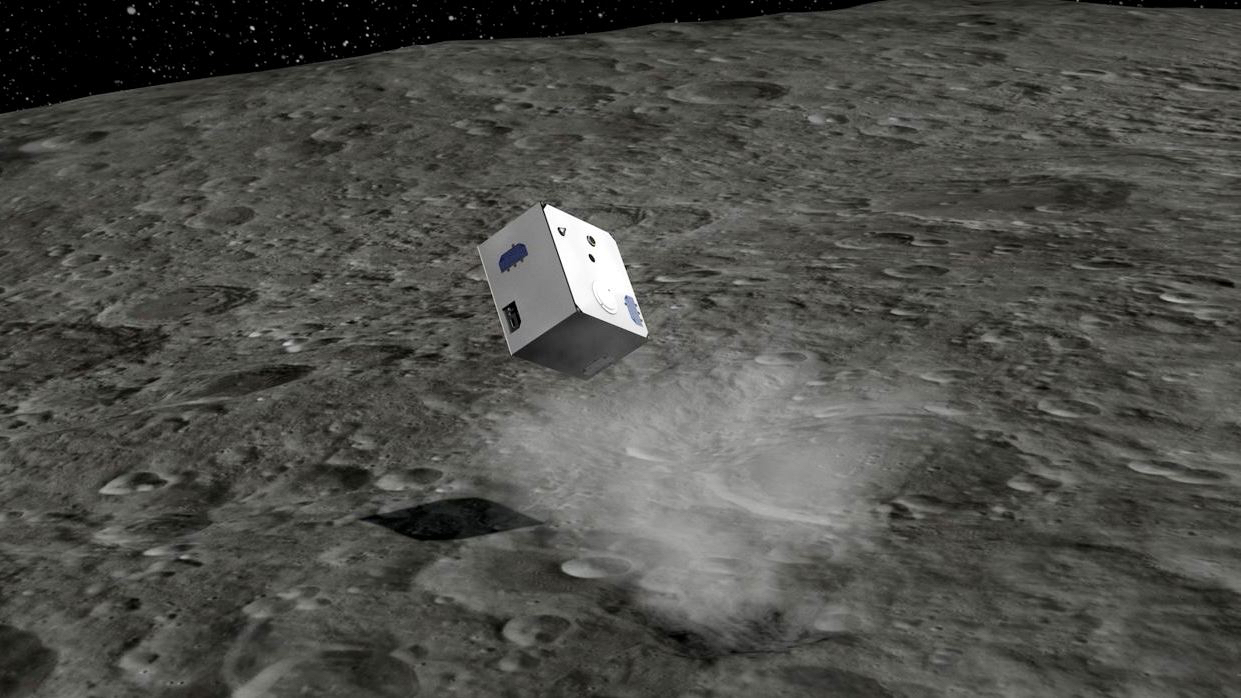
Die Fortsetzung der Hayabusa-Mission der japanischen Weltraumagentur JAXA führt eine Raumsonde zum Asteroiden Ryugu. Mit an Bord ist der Lander MASCOT, der vom Institut für Raumfahrtsysteme des DLR in Bremen entwickelt wurde. Die Mission verläuft außerordentlich erfolgreich und befindet sich derzeit auf dem Rückflug zur Erde.
Dauer:
2 Stunden
3 Minuten
Aufnahme:
15.01.2020

Tra-Mi Ho |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
DLR - Institut für Raumfahrtsysteme - Home
Hayabusa 2 – Wikipedia
Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia
Guidance, navigation, and control - Wikipedia
ZARM – Wikipedia
Fallturm Bremen – Wikipedia
Meteor von Tscheljabinsk – Wikipedia
Tunguska-Ereignis – Wikipedia
RZ071 Asteroidenabwehr | Raumzeit
NEAR Shoemaker – Wikipedia
(433) Eros – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
(2867) Šteins – Wikipedia
(21) Lutetia – Wikipedia
Japan Aerospace Exploration Agency – Wikipedia
Hayabusa (Raumsonde) – Wikipedia
Micro/Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid – Wikipedia
Tschurjumow-Gerassimenko – Wikipedia
Asteroid – Wikipedia
Planetary Protection – Wikipedia
Hayabusa 2 – Wikipedia
(162173) Ryugu – Wikipedia
Internationale Astronomische Union – Wikipedia
Jet Propulsion Laboratory – Wikipedia
ESA Science & Technology - Marco Polo Mission Summary
Astronomische Einheit – Wikipedia
Endlicher Automat – Wikipedia
Gravitationskonstante – Wikipedia
Regolith – Wikipedia
OSIRIS-REx – Wikipedia
(101955) Bennu
RZ083 SpaceX
Über die Geschichte, Methodik und Philosophie des amerikanischen Raumfahrtunternehmens

Kaum ein Unternehmen hat die Raumfahrt in den letzten Jahren so umfangreich und nachhaltig umgekrempelt wie SpaceX. Das Projekt des ehemaligen PayPal-Gründers Elon Musk wurde 2002 gegründet und trat an, um mit einer von Grund auf neu entwickelten Rakete den Zugang zum All so günstig zu machen wie noch nie. 17 Jahre später lässt sich feststellen, dass SpaceX das Vorhaben gelungen ist. Die Falcon 9 Rakete hat nicht nur die Kosten erheblich gedrückt, sie hat auch der Raumfahrt durch die erstmalige Landung der ersten Stufe der Rakete wieder etwas von der Magie zurückgegeben, die die Raumfahrt in den 60er Jahren so geprägt hat. Auf Basis der selben Triebwerkstechnologie wurde mit der Falcon Heavy zudem die heute stärkste Rakete entwickelt und SpaceX ist jetzt dabei mit dem Starship-Projekt auch einen Transportweg zum Mars zu entwickeln.
Dauer:
2 Stunden
44 Minuten
Aufnahme:
18.11.2019

Hans Koenigsmann |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
- SpaceX – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Laser-in-situ-Keratomileusis – Wikipedia — de.wikipedia.org
- TUBSAT – Wikipedia — de.wikipedia.org
- BremSat – Wikipedia — de.wikipedia.org
- OHB – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Fallturm Bremen – Wikipedia — de.wikipedia.org
- ZARM – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Elon Musk – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Gwynne Shotwell – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Silicon Valley – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Arnold Schwarzenegger – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Falcon 1 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Kerosin – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Phenoplast – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Nockenwelle – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Falcon 9 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Nutzlastverkleidung – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Merlin (Raketentriebwerk) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Marshallinseln – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Kwajalein Missile Range – Wikipedia — de.wikipedia.org
- RadioShack – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Tic-Tac-Toe – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Dragon (Raumschiff) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Erdnähe – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Liste der Falcon-9- und Falcon-Heavy-Raketenstarts – Wikipedia — de.wikipedia.org
- SES World Skies – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Atlas (Rakete) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Sojus (Rakete) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Apollo 11 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Falcon Heavy – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Cape Canaveral Air Force Station – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Vandenberg Air Force Base – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Unbemannte schwimmende Landeplattform – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Gitterflosse – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Numerische Strömungsmechanik – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Grasshopper (Rakete) – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Scherwind – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Iain Banks – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Das Spiel Azad – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Starship und Super Heavy – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Dragon 2 – Wikipedia — de.wikipedia.org
- NASA – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Artemis-Programm – Wikipedia — de.wikipedia.org
- SpaceX und NASA
- Remote Manipulator System – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Automated Transfer Vehicle – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Starlink
- Starlink – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Tesla, Inc. – Wikipedia — de.wikipedia.org
- Iridium-Flare – Wikipedia — de.wikipedia.org
RZ082 Bodenerkundung auf dem Mars
Erkenntnisse aus den Lander- und Rovermissionen zum Mars der letzten Jahrzehnte
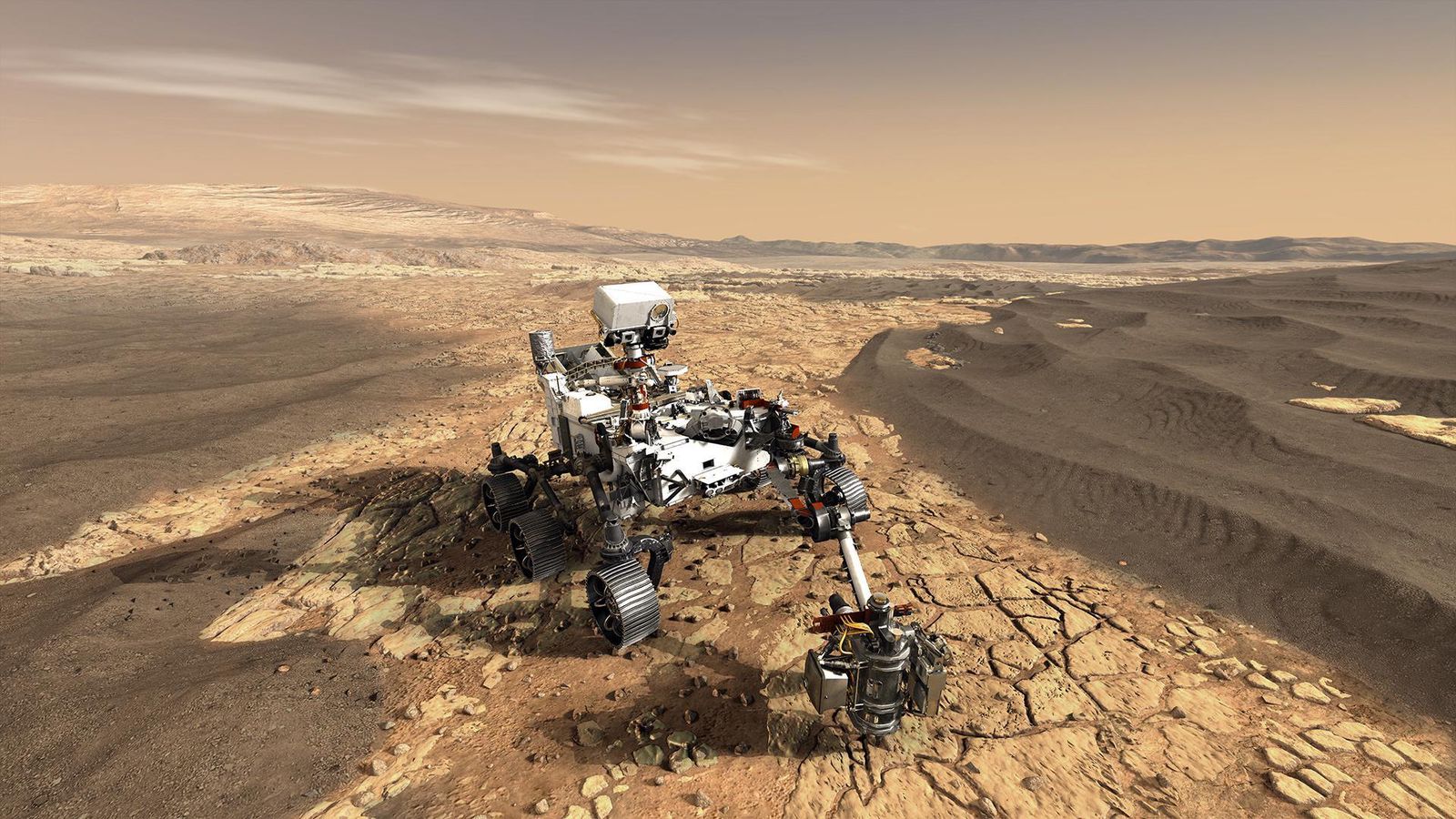
Der Mars ist und bleibt das interessanteste Objekt der Raumfahrt. Alle zwei Jahre starten neue Missionen zu unserem Nachbarplaneten und senden neue Sonden, Lander und Rover ab, um weitere Erkenntnisse über Geologie, Geochemie und andere Aspekte zu gewinnen. Denn das Wissen um Geschichte, Aufbau und Struktur des Mars liefern eine Menge Informationen über die Entstehung des Sonnensystems und damit auch neue Erkenntnisse über die Erde. Die extrem erfolgreichen und auch gut aufeinander abgestimmten Missionen der NASA und ESA der letzten Jahrzehnte haben uns nun ein interessantes Instrumentarium, um diese Erforschung weiter voranzutreiben und neue Missionen sind bereits in den Startlöchern. In dieser Ausgabe von Raumzeit schauen wir, was die bisherigen Missionen geleistet haben und was wir dabei über den Mars gelernt haben.
Dauer:
2 Stunden
7 Minuten
Aufnahme:
09.11.2019

Susanne Schwenzer |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
RZ048 Mars Express | Raumzeit
RZ049 Der Mars | Raumzeit
Mineralogie – Wikipedia
Max-Planck-Institut für Polymerforschung
Alphapartikel-Röntgenspektrometer – Wikipedia
Gestein – Wikipedia
Basalt – Wikipedia
Granit – Wikipedia
Quarzuhr – Wikipedia
Schwingquarz – Wikipedia
Zement – Wikipedia
Arsen – Wikipedia
Geochemie – Wikipedia
Marsmeteorit – Wikipedia
Heinrich Wänke – Wikipedia
Alpha-Magnet-Spektrometer – Wikipedia
Mars Pathfinder – Wikipedia
Mars 2020 – Wikipedia
Krypton – Wikipedia
Xenon – Wikipedia
Edelgase – Wikipedia
Isotopenverhältnis – Wikipedia
Antarctic Search for Meteorites program – Wikipedia
Blaueisfeld – Wikipedia
Milton Keynes – Wikipedia
The Open University – Wikipedia
Fernuniversität in Hagen – Wikipedia
Umgedrehter Unterricht – Wikipedia
Viking – Wikipedia
Carl Sagan – Wikipedia
Unser Kosmos – Wikipedia
Pale Blue Dot – Wikipedia
Mariner – Wikipedia
Perchlorate – Wikipedia
Mars Pathfinder – Wikipedia
Seasonal flows on warm Martian slopes - Wikipedia
ExoMars – Wikipedia
Biomarker – Wikipedia
Mars Exploration Rover – Wikipedia
Spirit (Raumsonde) – Wikipedia
Opportunity – Wikipedia
Redoxreaktion – Wikipedia
Salzsee – Wikipedia
Chloride – Wikipedia
Bromide – Wikipedia
Tonminerale – Wikipedia
Sulfate – Wikipedia
Victoria (Marskrater) – Wikipedia
Geomorphologie – Wikipedia
Mäander – Wikipedia
Konglomerat (Gestein) – Wikipedia
Internationale Astronomische Union – Wikipedia
Mars Science Laboratory – Wikipedia
InSight – Wikipedia
Gale (Marskrater) – Wikipedia
Mars Reconnaissance Orbiter – Wikipedia
7 Minutes of Terror: The Challenges of Getting to Mars
Hämatit – Wikipedia
Stratigraphie (Geologie) – Wikipedia
Noachian - Wikipedia
Hesperian (Mars) – Wikipedia
Amazonian (Mars) - Wikipedia
Planetary Protection – Wikipedia
Bärtierchen – Wikipedia
Panspermie – Wikipedia
RZ081 Hubble-Weltraumteleskop
Das UV-Teleskop im Weltall ist eines der erfolgreichsten Projekte der Raumfahrt und Astronomie
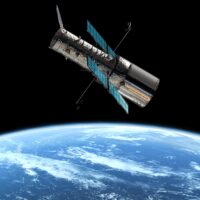
Das Hubble-Weltraumteleskop war auch ein wichtiger Begleiter für die Exoplaneten-Erforschung und als Späher für Missionen wie der Sonde "New Horizons", deren Flug zum Pluto durch Hubbles Hilfe noch ein weiteres Ziel nachgeliefert werden konnte. In der verbleibenden Restlaufzeit von ca. 15 bis maximal 20 Jahren wird Hubble für weitere Erkenntnisse sorgen. Die Situation der Weltraumteleskopie wird danach aber anders aussehen, da bislang kein entsprechendes Nachfolgeprojekt im gleichen Wellenbereich in Planung ist. Das James-Webb-Teleskop wird im Infrarotbereich weitersuchen und interessante Erkenntnisse über die Vergangenheit des Universums aufspüren, doch wird der Welt ein wichtiges Auge fehlen, wenn Hubble verglüht sein wird.
Dauer:
1 Stunde
44 Minuten
Aufnahme:
22.10.2019

Klaus Werner |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
RZ080 Europäische Raumfahrtpolitik
Die Zukunft der ISS und anderer Raumfahrtprojekte

Dauer:
1 Stunde
28 Minuten
Aufnahme:
23.09.2019

Hansjörg Dittus |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik der Universität München
Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Wikipedia
Internationale Raumstation – Wikipedia
Klimawandel – Wikipedia
Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia
Meteosat – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
Chang’e-4 – Wikipedia
Ariane (Rakete) – Wikipedia
SpaceX – Wikipedia
Raumfahrtzentrum Guayana – Wikipedia
Lunar Orbital Platform-Gateway – Wikipedia
RZ079 Kosmische Chemie
Die Bedeutung chemischer Prozesse bei der Entstehung von Sternensystemen und dem Leben

Astrochemiker ergründen das All auf verschiedenen Wegen: Spektrale Analysen erlauben schon lange, chemische Elemente auf fernen Sternen, in Gaswolken oder auf Planeten zu bestimmen. Gesteine von Meteoriten oder vom Mond erlaubten Laborexperimente. Zunehmend reisen auch verkleinerte Massenspektrometer ins Sonnensystem. Bei kleinen Körpern wie Kometen und Asteroiden geht es dabei um die Suche nach unserem Ursprung: Woher kamen Wasser und Bausteine des Lebens auf die Erde?
Dauer:
1 Stunde
42 Minuten
Aufnahme:
18.09.2019

Kathrin Altwegg |
Wir sprechen über die zunehmende Bedeutung der Chemie bei der Erforschung des Universums, ihrer Rolle bei der Entstehung des Sonnensystems und was wir als Leben ansehen und dieses an anderen Orten im All zu entdecken gedenken.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
- Center for Space and Habitability
Giotto (Sonde) – Wikipedia
Halleyscher Komet – Wikipedia
RZ020 Giotto und Rosetta
Molekül – Wikipedia
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia
Urknall – Wikipedia
Nukleosynthese – Wikipedia
Wasserstoff – Wikipedia
Helium – Wikipedia
Eisen – Wikipedia
Cobalt – Wikipedia
Supernova – Wikipedia
Neutronenstern – Wikipedia
Kilonova – Wikipedia
RZ067 Neutronensterne | Raumzeit
Herschel-Weltraumteleskop – Wikipedia
Spitzer-Weltraumteleskop – Wikipedia
Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
Molekülwolke – Wikipedia
Dunkelwolke – Wikipedia
Katalyse – Wikipedia
Komet – Wikipedia
Tschurjumow-Gerassimenko – Wikipedia
Deuterium – Wikipedia
103P/Hartley 2 – Wikipedia
Theia (Protoplanet) – Wikipedia
Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt) – Wikipedia
Chondrit – Wikipedia
Asteroid – Wikipedia
Isotop – Wikipedia
Xenon – Wikipedia
Organische Chemie – Wikipedia
Aromaten – Wikipedia
Aminosäuren – Wikipedia
Chemische Evolution – Wikipedia
Mars Science Laboratory – Wikipedia
Saturn (Planet) – Wikipedia
Titan (Mond) – Wikipedia
Enceladus (Mond) – Wikipedia
Martian Moons Exploration - Wikipedia
Protoplanetare Scheibe – Wikipedia
Exoplanet – Wikipedia
Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Transitmethode – Wikipedia
Comet Interceptor – Wikipedia
1I/ʻOumuamua – Wikipedia
Maschinelles Lernen – Wikipedia
RZ078 Pluto und New Horizons
Der Verlauf der Mission in den Kuipergürtel und erste Erkenntnisse über den Zwergplaneten Pluto

Dauer:
2 Stunden
1 Minute
Aufnahme:
05.07.2019

Martin Pätzold |
Martin Pätzold war für einige Projekte und Instrumente auf New Horizons zuständig und hat damit unter anderem das Schwerefeld und die Atmosphäre des Pluto untersucht.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Rheinisches Institut für Umweltforschung an der Universität zu Köln, EURAD
Universität zu Köln – Wikipedia
Rosetta (Sonde) – Wikipedia
New Horizons – Wikipedia
Mars Express – Wikipedia
Venus Express – Wikipedia
Lucy (Raumsonde) – Wikipedia
COROT (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia
Transiting Exoplanet Survey Satellite – Wikipedia
Pluto – Wikipedia
Uranus (Planet) – Wikipedia
Neptun (Planet) – Wikipedia
Charon (Mond) – Wikipedia
Keplersche Gesetze – Wikipedia
Transpluto – Wikipedia
Akkretionsscheibe – Wikipedia
Bahnneigung – Wikipedia
Beugung (Physik) – Wikipedia
Mike Brown (@plutokiller) | Twitter
Kuipergürtel – Wikipedia
(136199) Eris – Wikipedia
Gasplanet – Wikipedia
Tschurjumow-Gerassimenko – Wikipedia
Silicate – Wikipedia
Eris (Mythologie) – Wikipedia
Zwergplanet – Wikipedia
(4) Vesta – Wikipedia
Plutoid – Wikipedia
Jet Propulsion Laboratory – Wikipedia
Radionuklidbatterie – Wikipedia
Brutreaktor – Wikipedia
Stanford University – Wikipedia
Doppler-Effekt – Wikipedia
Swing-by – Wikipedia
Astronomische Einheit – Wikipedia
(486958) 2014 MU69 – Wikipedia
Bitrate – Wikipedia
Signal-Rausch-Verhältnis – Wikipedia
Zentaur (Asteroid) – Wikipedia
Heliosphäre – Wikipedia
Planet Neun – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
Oortsche Wolke – Wikipedia
RZ077 Pflanzen im Weltraum
Biologische Systeme zur Ernährung und Klimasteuerung für Raumfahrtmissionen

Dauer:
1 Stunde
37 Minuten
Aufnahme:
04.07.2019

Stefan Belz |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Apollo 13 (Film) – Wikipedia
Luft- und Raumfahrttechnik B.Sc. | Studiengang | Universität Stuttgart
Internationale Raumstation – Wikipedia
RZ021 Weltraummedizin | Raumzeit
Ernst Messerschmid – Wikipedia
Herman Hollerith Zentrum
Alge – Wikipedia
Photobioreaktor – Wikipedia
Chlorella – Wikipedia
Pflanzenbewegung – Wikipedia
Gravitaxis – Wikipedia
Chlorophylle – Wikipedia
Aeroponik – Wikipedia
Hydrokultur – Wikipedia
Schaumkressen – Wikipedia
Modellorganismus – Wikipedia
Tomate – Wikipedia
EDEN-ISS
Biosphäre 2 – Wikipedia
Yuegong-1 - Wikipedia
Pflanzen im Weltraum – Wikipedia
RZ064 ISS-Expedition 42 | Raumzeit
Sabatier-Prozess – Wikipedia
Methan – Wikipedia
EuCROPIS – Wikipedia
Terraforming – Wikipedia
Berge des ewigen Lichts – Wikipedia
Der Marsianer – Rettet Mark Watney – Wikipedia
RZ027 Mars500 | Raumzeit
Pilze – Wikipedia
RZ076 Der Gaia-Sternkatalog
Der auf der Mission Gaia basierende Sternenkatalog revolutioniert die Astronomie und Astrophysik
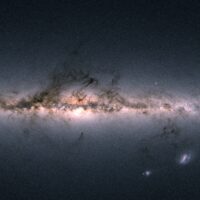
Dauer:
2 Stunden
44 Minuten
Aufnahme:
21.06.2019

Stefan Jordan |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
RZ057 Gaia
Zentrum für Astronomie: Astronomisches Rechen-Institut
Astrometrie – Wikipedia
Spektroskopie – Wikipedia
Milchstraße – Wikipedia
Apollo 11 – Wikipedia
[+] Apollo 11 in Real-time
Saturn (Rakete) – Wikipedia
Lichtjahr – Wikipedia
Weißer Zwerg – Wikipedia
Hipparcos – Wikipedia
Winkelsekunde – Wikipedia
Parallaxe – Wikipedia
Asteroid – Wikipedia
Komet – Wikipedia
Exoplanet – Wikipedia
Rotverschiebung – Wikipedia
Gaia DR2 – Wikipedia
Raketentriebwerk – Wikipedia
Transitmethode – Wikipedia
Transneptunisches Objekt – Wikipedia
Magellansche Wolken – Wikipedia
Zwerggalaxie – Wikipedia
Lokale Gruppe – Wikipedia
Dreiecksnebel – Wikipedia
Andromedagalaxie – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Lagrange-Punkte – Wikipedia
James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Wikipedia
eROSITA – Wikipedia
Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia
Herschel-Weltraumteleskop – Wikipedia
Interferometrie – Wikipedia
Gaia (Mythologie) – Wikipedia
Fokus – Wikipedia
Lissajous-Figur – Wikipedia
Aberration (Astronomie) – Wikipedia
CCD-Sensor – Wikipedia
Spektralklasse – Wikipedia
Prisma (Optik) – Wikipedia
Spektrallinie – Wikipedia
Ekliptik – Wikipedia
Stellardynamik – Wikipedia
DPAC Consortium - Gaia - Cosmos
Europäisches Weltraumastronomiezentrum – Wikipedia
Radialgeschwindigkeit – Wikipedia
Big Data – Wikipedia
Doppelstern – Wikipedia
Swing-by – Wikipedia
The Milky Way as You’ve Never Seen It Before – AMNH SciCafe - YouTube
ESA Science & Technology: Gaia-Enceladus stars across the sky
Sagittarius-Zwerggalaxie – Wikipedia
Sternstrom – Wikipedia
Kugelsternhaufen – Wikipedia
Dunkelwolke – Wikipedia
Interstellares Medium – Wikipedia
Small-JASMINE
Gravitationslinseneffekt – Wikipedia
Arthur Stanley Eddington – Wikipedia
Allgemeine Relativitätstheorie – Wikipedia
Laniakea – Wikipedia
Balkenspiralgalaxie – Wikipedia
Halo (Astronomie) – Wikipedia
Messier 44 – Wikipedia
Offener Sternhaufen – Wikipedia
Klassifizierung der Sterne – Wikipedia
Kernfusion – Wikipedia
Kinematik – Wikipedia
Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia
Zentrum für Astronomie: Gaia Sky
Toni Sagristà Sellés - YouTube
RZ075 Geologische Zeit
Die Bestimmung des Alters der Erde und des Sonnensystems

Dauer:
1 Stunde
57 Minuten
Aufnahme:
20.05.2019

Karl Urban |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Geologie
raumfahrer.net
Die Weltraumreporter
Humangenomprojekt
Geologische Zeitskala
Charles Darwin
Evolutionstheorie
Dinosaurier
Paläontologie
Leitfossil
Nicolaus Steno
Stratigraphisches Prinzip
Stratigraphie (Geologie)
William Smith (Geologe)
Kreationismus
Plutonismus (geologisch)
Vulkanismus
Thermodynamik
William Thomson, 1. Baron Kelvin
Dendrochronologie
Jahresring
Trias (Geologie)
Island
Pyroklastisches Sediment (Tephra)
Eisbohrkern
Radioaktivität
Kalium
Uran
Halbwertszeit
Magma
Isotop
40K-Messung
Supernova
Radiokarbonmethode
Alfred Wegener
Kontinentaldrift
Plattentektonik
Marie Tharp
Sonar
Vulkanit
Erdmagnetfeld
Magnetostratigraphie
Subduktion
Kambrium
Hadaikum
Methan
Sauerstoff
Stromatolith
Wasserstoff
Helium
Kernfusion
Nebel (Astronomie)
Protoplanetare Scheibe
Planetesimal
Zirkon
Lunare Zeitskala
Apollo-Programm
Mare (Mond)
Mare Imbrium
Mondkrater
Gerhard Neukum
Zeolithe (Stoffgruppe)
Meteorit
Alessandro Morbidelli
Nizza-Modell
Bahnresonanz
Kuipergürtel
Mars Science Laboratory
Gale (Marskrater)
Südpol-Aitken-Becken
Chang’e-4
Chang’e 5
Cyanobakterien
Photosynthese
Sonnenaktivität
Eiszeitalter
Chemische Evolution
Chicxulub-Krater
Europa (Mond)
Enceladus (Mond)
Perm-Trias-Grenze
Massenaussterben
Superkontinent
Flöz
Sibirischer Trapp
Saurer Regen
Präkambrium
Kreide-Paläogen-Grenze
Karbon
Gammablitz
Gaia (Raumsonde)
Rosetta (Sonde)
RZ074 Schwarze Löcher
Über Singularitäten und das Event Horizon Telescope Projekt, dass das erste Bild eines Schwarzen Lochs produziert hat

Doch gab es in den letzten Jahren wichtige wissenschaftliche Fortschritte, die uns das Mysterium der Schwarzen Löcher neu zugänglich gemacht haben. So konnten erstmals Gravitationswellen gemessen werden, die ihren Ursprung in der Verschmelzung Schwarzer Löcher mit ihresgleichen und auch mit Neutronensternen haben.
Und in diesem Jahr konnte das Event Horizon Telescope Projekt erstmals auch den unmittelbaren Raum um ein Schwarzes Loch konkret abbilden: das Umfeld eines supermassiven schwarzen Lochs, das in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung in der Galaxis M87 sein Unwesen treibt, konnte nun aus tausenden von Einzelbeobachtungen visualisiert werden und erlaubt neue Einblicke und Überprüfungen gängiger Theorien zu Entstehung und Wesen dieser Orte.
Dauer:
1 Stunde
51 Minuten
Aufnahme:
02.05.2019

Michael Kramer |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Schwarzes Loch
Astrophysik
Pulsar
Relativitätstheorie
LIGO
Radioastronomie
Radioteleskop Effelsberg
Green-Bank-Observatorium
FAST (Radioteleskop)
Atacama Pathfinder Experiment
South Pole Telescope
Lovell Telescope
Sardinia Radio Telescope
Passageninstrument
Neutronenstern
Virgo (Gravitationswellendetektor)
Laniakea
Dunkle Materie
Dunkle Energie
Licht
Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt)
Karl Schwarzschild
Albert Einstein
Keplerbahn
Sagittarius A* <https://de.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*>
Akkretionsscheibe
Plasma (Physik)
Zustand (Quantenmechanik)
Entartete Materie
Betastrahlung
Pauli-Prinzip
Weißer Zwerg
Supernova
Hypernova
Gammablitz
Singularität (Astronomie)
Ereignishorizont
Raumzeit
Kernfusion
Hawking-Strahlung
Stephen Hawking
Quasar
Jet (Astronomie)
Gravitationswelle
Binary black hole
Halo (Lichteffekt)
Event Horizon Telescope
Heino Falcke (Astronom)
Europäischer Forschungsrat
Very Long Baseline Interferometry
Messier 87
Virgo-Galaxienhaufen
Virgo-Superhaufen
MIT Haystack Observatory
Blade Runner
Apertur
RadioAstron
xkcd: M87 Black Hole Size Comparison
Heliosphäre
Newtonsches Gravitationsgesetz
RZ073 IceCube Neutrino Observatory
Das Experiment am Südpol zur Messung kosmischer Neutrinostrahlung
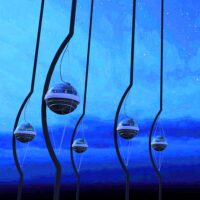
Dauer:
1 Stunde
37 Minuten
Aufnahme:
02.06.2018

Marcel Usner |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Deutsches Elektronen-Synchrotron – Wikipedia
Astronomie – Wikipedia
Astroteilchenphysik – Wikipedia
Atom – Wikipedia
Proton – Wikipedia
Neutron – Wikipedia
Quark (Physik) – Wikipedia
Gluon – Wikipedia
Elementarteilchen – Wikipedia
Teilchenbeschleuniger – Wikipedia
Fundamentale Wechselwirkung – Wikipedia
Halbwertszeit – Wikipedia
Elektron – Wikipedia
Angeregter Zustand – Wikipedia
Standardmodell – Wikipedia
Spin – Wikipedia
Masse (Physik) – Wikipedia
Ladung (Physik) – Wikipedia
Austauschteilchen – Wikipedia
Photon – Wikipedia
Gravitation – Wikipedia
Higgs-Boson – Wikipedia
Neutrino – Wikipedia
Myon – Wikipedia
τ-Lepton – Wikipedia
Wolfgang Pauli – Wikipedia
Schwache Wechselwirkung – Wikipedia
Blasenkammer – Wikipedia
Kosmische Strahlung – Wikipedia
Antares (Neutrinoteleskop) – Wikipedia
Antarctic Muon And Neutrino Detector Array – Wikipedia
IceCube – Wikipedia
Tscherenkow-Strahlung – Wikipedia
Südpol – Wikipedia
McMurdo-Station – Wikipedia
RZ072 Die Zukunft der Raumfahrt
Der Mond und Mars im Fokus der bemannten Raumfahrt

Dauer:
1 Stunde
12 Minuten
Aufnahme:
13.04.2018

Matthias Maurer |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Matthias Maurer – Wikipedia
Samantha Cristoforetti – Wikipedia
Europäisches Astronautenzentrum – Wikipedia
Centre Spatial Guyanais – Wikipedia
Ariane 5 – Wikipedia
Ariane 6 – Wikipedia
Sojus (Raumschiff) – Wikipedia
Tiangong 2 – Wikipedia
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik – Wikipedia
RWTH Aachen – Wikipedia
3D-Druck – Wikipedia
Sintern – Wikipedia
Apollo 13 – Wikipedia
Mond – Wikipedia
Mars (Planet) – Wikipedia
Mikrometeorit – Wikipedia
Apollo 18 – Wikipedia
Apollo 19 – Wikipedia
Apollo 20 – Wikipedia
Per Anhalter durch die Galaxis – Wikipedia
Orion (Raumschiff) – Wikipedia
SpaceX – Wikipedia
Blue Origin – Wikipedia
xkcd: Gravity Wells
Regolith – Wikipedia
Google Lunar X-Prize – Wikipedia
Interkosmos – Wikipedia
Internationale Raumstation – Wikipedia
Weltraummüll – Wikipedia
Jan Wörner: Moon Village - Menschen und Roboter gemeinsam auf dem Mond
RZ071 Asteroidenabwehr
Die Bedrohung der Erde aus dem All und was dagegen getan wird

Dauer:
1 Stunde
18 Minuten
Aufnahme:
07.02.2018

Rüdiger Jehn |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Technische Universität Darmstadt – Wikipedia
BepiColombo – Wikipedia
ESA’s bug-eyed telescope to spot risky asteroids / Space Situational Awareness / Operations / Our Activities / ESA
OHB – Wikipedia
Europäische Südsternwarte – Wikipedia
Asteroidengürtel – Wikipedia
Oortsche Wolke – Wikipedia
2012 TC4 – Wikipedia
Meteor von Tscheljabinsk – Wikipedia
1I/ʻOumuamua – Wikipedia
Interstellar – Wikipedia
ESA - NEO Coordination Centre
neo.ssa.esa.int/risk-page
Palermo-Skala – Wikipedia
Close Approaches - ESA - European Space Agency
Envisat – Wikipedia
Double Asteroid Redirection Test (DART) Mission | NASA
AIDA: Die Abwehr von Asteroiden im Test / Germany / ESA in your country / ESA
Falcon Heavy Demonstration Mission – Wikipedia
Ariane 5 – Wikipedia
Satellitenkollision am 10. Februar 2009 – Wikipedia
Quiet Earth – Das letzte Experiment – Wikipedia
Asteroid Day – Wikipedia
Tunguska-Ereignis – Wikipedia
RZ070 Weltraumrecht
Die rechtlichen Bedingungen der Raumfahrt und die Entwicklung eines globalen Rechtssystems

Dauer:
1 Stunde
2 Minuten
Aufnahme:
06.02.2018

Stephan Hobe |
Shownotes
Glossar
Institut für Luft- und Weltraumrecht: Institut für Luft- und Weltraumrecht
Weltraumrecht – Wikipedia
Otto Schreiber (Jurist) – Wikipedia
Alex Meyer – Wikipedia
Wernher von Braun – Wikipedia
Vladimír Mandl – Wikipedia
Vereinte Nationen – Wikipedia
Weltraumvertrag – Wikipedia
Weltraumrettungsübereinkommen – Wikipedia
Übereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände – Wikipedia
Weltraumregistrierungsübereinkommen – Wikipedia
Mondvertrag – Wikipedia
Interkontinentalrakete – Wikipedia
Völkerrecht – Wikipedia
Weltraummüll – Wikipedia
Internationale Raumstation – Wikipedia
Columbus (ISS) – Wikipedia
Canadarm2 – Wikipedia
Weltraumbahnhof – Wikipedia
Airbus – Wikipedia
Europäische Weltraumorganisation – Wikipedia
Europäisches Raumflugkontrollzentrum – Wikipedia
Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia
Europäisches Weltraumforschungsinstitut – Wikipedia
Arianespace – Wikipedia
SpaceX – Wikipedia
Centre Spatial Guyanais – Wikipedia
RZ069 Copernicus Open Data Strategy
Das Erdbeobachtungsprogram der EU geht neue Wege bei der Zugänglichkeit der Daten

Dauer:
1 Stunde
31 Minuten
Aufnahme:
17.01.2018

Bianca Hoersch |
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn – Wikipedia
Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) – Wikipedia
Copernicus
Copernicus / Observing the Earth / Our Activities / ESA
Open Access at the European Space Agency | Open Access at ESA
Europäisches Weltraumforschungsinstitut – Wikipedia
Sentinel-1 – Wikipedia
Sentinel-2 – Wikipedia
Sentinel-3 – Wikipedia
Höhenmesser – Wikipedia
Sentinel-5P – Wikipedia
Weltraummüll – Wikipedia
Space Situational Awareness – Wikipedia
Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC) – Wikipedia
Envisat – Wikipedia
Korallenriff – Wikipedia
Spitzbergen (Inselgruppe) – Wikipedia
European Data Relay Satellite – Wikipedia
OpenStreetMap – Wikipedia
Sentinel Online - ESA
Start-up programmes | Copernicus
Copernicus Masters
Copernicus Relays | Copernicus
Sinergise
Fostering the Uptake of Copernicus and Space Applications
RZ068 Bodengestützte Astronomie
Der Blick ins All von der Erdoberfläche aus

Ich spreche mit dem Astrophysiker und Professor für Beobachtende Astronomie an der Universität Hamburg Jochen Liske über Voraussetzungen für die Beobachtung des Alls, die Entwicklung der Teleskop-Technologie über die Zeit, die Herausforderungen der Astronomie als solcher, die Europäische Südsternwarte und ihre Großteleskope, künftige Projekte wie dem Extremely Large Telescope und dem kommenden Zeitalter der Multi-Messenger-Astronomie.
Dauer:
1 Stunde
48 Minuten
Aufnahme:
16.11.2017

Jochen Liske |
Mit dieser Sendung feiert Raumzeit auch sein 7-jähriges Bestehen: im November 2010 erschien die erste Ausgabe und anläßlich dieses Geburtstags ändert sich nun auch die bekannte Intro- und Outro-Musik des Podcasts. Ich hoffe, Euch gefällt die neue Variante so gut wie mir. Vielen Dank an Florian Erlbeck für die abermalig großartige Produktion, der schon so viele Podcasts der Metaebene klanglich ausgestaltet hat.
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
Glossar
Hamburger Sternwarte – Wikipedia
ESA Hubblecast
Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia
Contact (1997) – Wikipedia
Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie – Wikipedia
Teleskop – Wikipedia
Hans Lipperhey – Wikipedia
Galileo Galilei – Wikipedia
Fernrohr – Wikipedia
Spiegelteleskop – Wikipedia
Keck-Observatorium – Wikipedia
Europäische Südsternwarte
Paranal-Observatorium – Wikipedia
Southern African Large Telescope – Wikipedia
Gran Telescopio Canarias – Wikipedia
Smog – Wikipedia
Mauna Kea – Wikipedia
Mauna-Kea-Observatorium – Wikipedia
Radioteleskop Effelsberg – Wikipedia
Humboldtstrom – Wikipedia
Inversionswetterlage – Wikipedia
Anden – Wikipedia
Atacama-Wüste – Wikipedia
Patagonien – Wikipedia
La-Silla-Observatorium – Wikipedia
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia
Europäische Weltraumorganisation – Wikipedia
CERN – Wikipedia
European Molecular Biology Laboratory – Wikipedia
European XFEL – Wikipedia
Extremely Large Telescope – Wikipedia
Interferometrie – Wikipedia
Laminare Strömung – Wikipedia
Kalibrierung – Wikipedia
James Webb Space Telescope – Wikipedia
Lyndon B. Johnson Space Center – Wikipedia
Exoplanet – Wikipedia
Expansion des Universums – Wikipedia
Dunkle Materie – Wikipedia
Dunkle Energie – Wikipedia
Gravitationswelle – Wikipedia
LIGO – Wikipedia
Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia
Neutrino – Wikipedia
IceCube – Wikipedia
Kosmische Strahlung – Wikipedia
Pierre-Auger-Observatorium – Wikipedia
Schwarzes Loch – Wikipedia
Neutronenstern – Wikipedia
Gammablitz – Wikipedia
Kilonova – Wikipedia
RZ067 Neutronensterne
Ein Blick auf die Grenzen der Physik
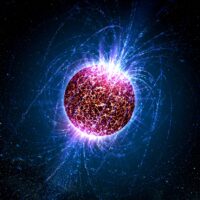
Dauer:
1 Stunde
59 Minuten
Aufnahme:
09.10.2017

Concettina Sfienti |
Das Gespräch wurde nur wenige Tage vor der Bestätigung der erstmaligen Detektion von Gravitationswellen aufgenommen, die von der Kollision zweier Neutronensterne ausging. Die potentiellen Auswirkungen, die solch ein Ereignis hat, werden entsprechend ausführlich diskutiert.
Shownotes
RZ066 Laserkommunikation
Optische Kommunikation revolutioniert die Raumfahrt

Dauer:
2 Stunden
2 Minuten
Aufnahme:
02.03.2017

Igor Zayer |
Shownotes
Glossar
Optik
Europäisches Raumflugkontrollzentrum
Sonnenphysik
Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC)
Glasfaser
ETH Zürich
Solar and Heliospheric Observatory
The Michelson Doppler Imager
Polarisation
Ultraviolettstrahlung
Polarisationsfilter
Radioastronomie
SOHO
Telemetry, Tracking and Command (TT&C)
Amplituden- und Phasenmodulation (APSK)
Doppler-Effekt
Rosetta
Frequenzband
LEOP
Interferenz
Internationale Fernmeldeunion (ITU)
Phased-Array-Antenne
Europäische Südsternwarte (ESO)
Active Pixel Sensor
Wärmebildkamera
SPOT
Artemex
Festkörperlaser
Phasenumtastung
Laser Communication Terminal
Copernicus
Envisat
Puls-Pausen-Modulation
QR-Code
Apertur
Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE)
Geodät
Retroreflektor
Künstlicher Leitstern
Adaptive Optik
Photon
Shower Curtain Effect
Kohärenz
ESTRACK
Streulicht
Lagrange-Punkt
Koronaler Massenauswurf
Quantenschlüsselaustausch
RZ065 Part Time Scientists
Eine private Mission auf dem Weg zu den Anfängen der Monderkundung

Dauer:
2 Stunden
35 Minuten
Aufnahme:
14.12.2016

Karsten Becker |
Shownotes
Glossar
Part-Time Scientists
SpaceX
26C3: A part time scientists' perspective of getting to the moon
Apollo-Programm
Mars Pathfinder
Spirit
Opportunity
ESTRACK
Google Lunar X Prize
Rodos
Regolith
DLR: ATON – Autonomous Terrain-based Optical Navigation
Mond-Kartografie
United Launch Alliance
Falcon 9
Falcon 1
Dnepr
Apsis (Perigäum/Apogäum)
Geostationäre Transferbahn
Lunar Lander
NASA sets guidelines for Apollo moon landing sites
Chang’e-3
Selektives Lasersintern
Johann-Dietrich Wörner
Dioskuren (Castor und Pollux)
Lunar Roving Vehicle
Cassini-Huygens
Orange Soil
Rosetta
Philae
How many people are in space right now
RZ064 ISS-Expedition 42
Einmal Weltall und zurück. Die Geschichte einer Reise zur Internationalen Raumstation
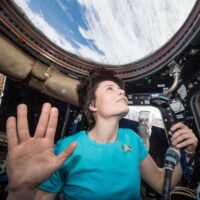
Dauer:
1 Stunde
14 Minuten
Aufnahme:
06.10.2016

Samantha Cristoforetti |
Shownotes
Glossar
Samantha Cristoforetti
Internationale Raumstation (ISS)
ISS-Expedition 42
Per Anhalter durch die Galaxis (Buch)
Per Anhalter durch die Galaxis (Film)
Tricia McMillan (Trillian)
Baikonur
Remote Manipulator System (Canadarm)
Juri Alexejewitsch Gagarin
Terry Wayne Virts
Quarantäne
Sokol-Raumanzug
Sojus
Gravitationskonstante (G)
Schwerelosigkeit
Columbus (ISS)
Cupola
Kibō
Dragon
Automated Transfer Vehicle (ATV)
Alpha-Magnet-Spektrometer
Circardiane Rhythmik
Stammzelle
Ostereopose
Leukozyt (Immunzelle)
Nutrimatic Drinks Dispenser
Espressomaschine
ISSpresso
Donald Pettit
Astronaut demos drinking coffee in space
Kapillarität
Leonard Nimoy
Kathryn Janeway
Gravity
RZ063 Galaxien und Kosmologie
Ein Blick hinter die Grenzen unseres Sonnensystems

Dauer:
1 Stunde
47 Minuten
Aufnahme:
26.09.2016

Marcus Brüggen |
Shownotes
Glossar
Hambuger Sternwarte
Low Frequency Array (LOFAR)
Refraktor
FAST-Observatorium
Radioteleskop Effelsberg
Arecibo-Observatorium
Synchrotronstrahlung
Pulsar
Neutronenstern
Voyager 1
Voyager 2
Komet
Proxima Centauri
Oortsche Wolke
Breakthrough Starshot
Magellansche Wolken
Shapley-Curtis-Debatte
Galaxie
Interstellarer Staub
Schwarzes Loch
Spiralgalaxie
Eliptische Galaxie
Irreguläre Galaxien
Zwerggalaxie
Parsec
Sonnenmasse
Lokale Gruppe
Ereignishorizont (Schwarzschildradius)
Supernova
Messier-87
Galaxienhaufen
Superhaufen
Filamente und Voids
Hubble Deep Field
Urknall
Hintergrundstrahlung
Dunkle Materie
Fritz Zwicki
Coma-Galaxienhaufen
Neptun
Uranus
Proton
Neutron
Wolfgang Pauli
Betastrahlung
Neutrino
Allgemeine Relativitätstheorie
Large Hadron Collider
Higgs-Boson
Supersymmetrie
Elektronenvolt
Dunkle Materie
Dunkle Energie
European Extremely Large Telescope (EELT)
Square Kilometer Array
James Webb Space Telescope
Athena
RZ062 Albert Einstein
Die Allgemeine Relativitätstheorie und die gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaft
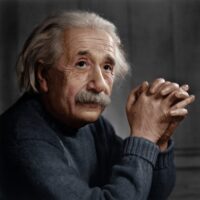
Dauer:
1 Stunde
47 Minuten
Aufnahme:
07.04.2016

Jürgen Renn |
Shownotes
Glossar
Albert Einstein
Allgemeine Relativitätstheorie
Wissenschaftsgeschichte
Max-Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte
Thomas S. Kuhn
Erkenntnistheorie
Anthropozän
Astronomie
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Marcel Grossmann
Brownsche Bewegung
Quantenhypothese
Hendrik Antoon Lorentz
Äther
Michele Besso
Mileva Marić
Akademie Olympia
Milchstraße
Wilhelm Herschel
Universum
Rede Einsteins anlässlich der Eröffnung der Funkausstellung in Berlin, 1930
Sonnenfinsternis
Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919
Lichtgeschwindigkeit
Nikolaus Kopernikus
Lorentz-Transformation
Rotverschiebung
Feldtheorie
Winkelschule
Quantenphysik
Kosmologische Konstante
Friedrich Adler
Edwin Hubble
Alexander Alexandrowitsch Friedmann
Georges Lemaître
Schwarzes Loch
Hermann Minkowski
Minkowski-Raum
Photon
Werner Heisenberg
Erwin Schrödinger
Aage Niels Bohr
Max Born
Quantenverschränkung
Äquivalenz von Masse und Energie
Walther Rathenau
Einstein–Szilárd letter
Wernher von Braun
Anthropozän
Sigmund Freud
RZ061 Gravitationswellenastronomie
Über die Entdeckung und Zukunft der Gravitationswellenastronomie
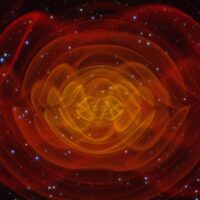
Doch nun wurden nicht nur die Wellen entdeckt: zugleich wurde das energetischste Ereignis gefunden, dass je von einem Menschen im Universum beobachtet wurde. Und nur diese Methode hatte überhaupt die Chance, zwei Schwarzen Löchern beim Aufeinandertreffen zuzuschauen. Damit öffnet die gelungene Messung nicht weniger als das Tor zu einer komplett neuen Form der Weltraumbeobachtung: der Gravitationswellenastronomie.
Dauer:
2 Stunden
49 Minuten
Aufnahme:
17.02.2016

Oliver Jennrich |
Shownotes
Glossar
Gravitationswelle
Gravitation
Laser Interferometer Space Antenna (LISA)
LISA Pathfinder
Albert Einstein
Interferometrie
Allgemeine Relativitätstheorie
Eddington
Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919
Freier Fall
Geodät
Kosmologische Konstante
Edwin Hubble
Planck
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)
Supernova
Raumkrümmung
Urknall
Lichtgeschwindigkeit
Elektrostatik
Elektrodynamik
Graviton
Photon
Quantenphysik
Pulsar
Joseph Webber
Niob
Laser
Kip Thorne
Ray Weiss
Heinz Billing
GEO600
ROSAT
LIGO
VIRGO
Triangulation
Supernova SN 1987A
KAGRA
Wärmerauschen
Kelvin
Schwarzes Loch
Neutronenstern
Doppelstern
Dunkle Materie
Gravitationswellenastronomie
James Webb Space Telescope
Filamente und Voids
Akkretionsscheibe
Gravitationslinseneffekt
Lagrange-Punkt
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
Deep Space Climate Observatory (DSCOVR)
Gold
Platin
RZ060 Extrasolare Planeten
Die Erforschung von Planeten anderer Sternensysteme
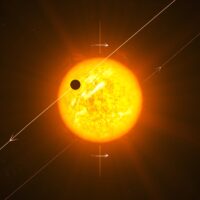
Dauer:
1 Stunde
44 Minuten
Aufnahme:
21.12.2015

Heike Rauer |
Sie lehrt auch an der TU Berlin „Planetare Physik“ und ist die Leiterin für die künftige ESA-Mission PLATO, die ab 2024 die Bobachtung von Exoplaneten auf eine neue Stufe stellen soll.
Shownotes
Glossar
Exoplanet
Infrared Space Observatory
Dimidium (51 Pegasi b)
Gasplanet
Migration
Radialgeschwindigkeit
Doppler-Effekt
Spektrallinie
Europäische Südsternwarte
Keplersche Gesetze
Pluto
Next Generation Transit Survey
COROT-Weltraumteleskop
Kepler-Weltraumteleskop
Kepler-10b
CHEOPS Weltraumteleskop
Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
Astroseismologie
PLATO
Lagrange-Punkte
Planck-Weltraumteleskop
Herschel-Weltraumteleskop
Gaia
Spitzer-Weltraumteleskop
James Webb Space Telescope
European Extremely Large Telescope
Darwin-Weltraumteleskop
RZ059 Kleinsatelliten
Kompakte Bauweisen für Satelliten erlauben effizientere Produktion und den Einsatz in der Lehre
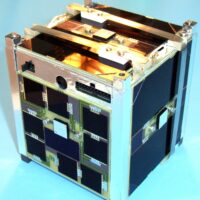
Dauer:
1 Stunde
38 Minuten
Aufnahme:
17.11.2015

Klaus Brieß |
Die hohen Anforderungen an die Miniaturisierung etablierter Raumfahrttechnologien wie z.B. Lagesteuerungen machen Kleinsatelliten schon heute zu einem Motor der Forschung.
Weiterhin diskutieren wir zukünftige Anwendungen von Kleinsatelliten: kleine, identische und damit in Massenherstellung produzierbare Systeme sind die ideale Basis für kostengünstige, weltumspannende Kommunikationsnetze, in dem die Satelliten auch untereinander permanent in Verbindung stehen.
Shownotes
Glossar
Technische Universität Ilmenau
Mars 96
Mars Express
BIRD
Juri Alexejewitsch Gagarin
Sigmund Jähn
Kleinsatellit
TUBSAT
Cubesat
Stabilisierung
Mobile Raketenbasis
Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum
Weltraummüll
Global Positioning System
Iridium
New Horizons
DLR: Space Bot Cup
BEESAT-4
RZ058 Philae
Die Landung auf einem Kometen

Dauer:
1 Stunde
33 Minuten
Aufnahme:
28.04.2015

Stephan Ulamec |
Stephan Ulamec erläutert das schwierige Thermaldesign, dass auf die extremen Bedingungen hin entwickelt werden musste, die Abwägungen, um die richtige Größe und Gewicht des Landers zu finden und schildert den Ablauf der kniffligen Landung auf dem Kometen und die zahlreichen Experimente, die schon auf dem Weg herab angestossen und auf dem Kometen erfolgreich durchgeführt werden konnten.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme war noch nicht klar, ob Philae nachdem die Batterien wenige Tage nach der Landung nicht mehr ausreichend geladen werden konnten, sich wieder melden würde. Wir sprechen aber über die Maßnahmen, die nach Wiederherstellung des Kontakts im Juni 2015 eingeleitet werden würden.
Shownotes
RZ057 Gaia
Die Vermessung unserer Galaxis geht in die nächste Runde
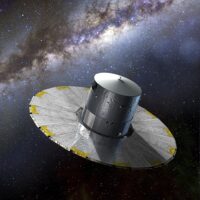
Die Gaia-Mission hat sich nun zum Ziel gesetzt, einen neuen Sternenkatalog zu schaffen, der deutlich umfangreicher und vor allem viel genauer sein soll als alle bisherigen Verzeichnisse. Neben der genauen Position und Entfernung werden dabei auch die dem Licht entlockbaren Informationen über die Zusammensetzung der Sonnen mit aufgenommen.
Auf 100 Milliarden Sterne wird unsere Galaxie grob geschätzt, gut ein Prozent davon möchte Gaia vermessen. Mit großer Präzision wurde für die Mission ein Kamerasystem geschaffen, das über einen Zeitraum von ca. 5 Jahren alle sichtbaren Sterne der Milchstraße bis zu 70 mal erfassen soll.
Der daraus resultierende Sternenkatalog wird in der Zukunft die Basis für viele neue Missionen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Beschaffenheit unseres Universums sein.
Dauer:
1 Stunde
43 Minuten
Aufnahme:
25.11.2013

Florian Renk Missionsanalyse, ESA |
Shownotes
Themen
Vorstellung — Die Vermessung der Milchstrasse — Positionsbestimmung — Der Beobachtungs-Orbit — Start des Satelliten — Die Reise zum Zielgebiets — Die Beobachtung der Galaxie — Die Startverschiebung — Der neue Starttermin
Links
Glossar
Europäisches Raumflugkontrollzentrum
ESA's Networking/Partnering Initiative (NPI)
SWARM
Euclid
Dunkle Energie
Dunkle Materie
Gaia
Hipparcos
Hipparchos
Astrometrie
Hipparcos-Katalog
Tycho-Katalog
Parallaxe
Supernova
Komet
Oortsche Wolke
Stabilisation
Lagrange-Punkte
Zentrifugalkraft
Schwerkraft
Lissajous-Figur
Albedo
Van-Allen-Gürtel
Halo-Orbit
Phased-Array-Antenne
Sojus-Fregat
Baikonur
Centre Spatial Guyanais
Ariane
Concurrent Design Facility
Vega
Ekliptik
ESTRACK
CCD-Sensor
Spektroskopie
Transponder
RZ056 Forschung in der ISS
Organisation und Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeit in der Raumstation
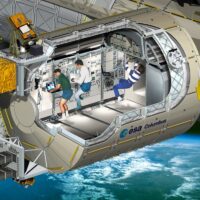
Dauer:
1 Stunde
51 Minuten
Aufnahme:
08.07.2013

Martin Zell Abteilungsleiter für die Nutzung der ISS, ESTEC, ESA |
Shownotes
Themen
Begrüßung und Vorstellung — Aufgaben der ISS — Organisation und Finanzierung der ISS — Wissenschaft an Bord — Research Announcement — Forschungsgebiete — Medizinische Forschung — Biologische Forschung — Astrobiologie — Physik — Fundamentalphysik — Astrophysik — Grundlagenforschung — Biologische Experimente — Internationale Forschungsteams — Astronautentraining — Physik und Materialforschung — Langzeitexperimente — Kurzzeitexperimente — Astronautenzyklus — Bedeutung der ISS für die Forschung — Betriebsdauer und Ausbau der ISS — Die ISS und die Öffentlichkeit — Resümee und Ausblick
RZ055 Planck
Das Weltraumteleskop zur Erforschung der Entstehung des Universums
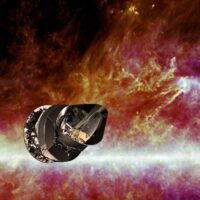
Das 13 Milliarden alte, ausgesprochen schwache Licht wird dabei aus allen Richtungen empfangen im Mikrowellenbereich empfangen. Durch massiv heruntergekühlte, langsam rotierende Instrumente gelang es Planck, eine hochauflösende, lückenlose Karte von der Entstehung unseres Universums zu erzeugen. 2013 konnte die 2009 in Betrieb gegangene Sonde ihren Auftrag erfolgreich abschließen.
Dauer:
1 Stunde
41 Minuten
Aufnahme:
05.06.2013

Nikolai von Krusenstiern ESOC, ESA |
Shownotes
Themen
Begrüßung und Vorstellung — Doppelmission Herschel-Planck — On-Board Software Maintenance — Der Urknall — Planck und die Hintergrundstrahlung — Die Planck-Instrumente — Raumfahrzeug und Flugbahnsteuerung — Datenübertragung — Missionsende — Den Satelliten aus dem Weg räumen — Sichere Abschaltung — Wissenschaftliche Ergebnisse
Links
Glossar
Planck-Weltraumteleskop
Herschel-Weltraumteleskop
Anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC)
Eberhard Karls Universität Tübingen
Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
Lagrange-Punkte
Trojaner
Weltraummüll
Kosmischer Mikrowellenhintergrund
Urknall
Albert Einstein
Reionisierungsepoche
Materia
Baryon
Kelvin
Wärmerauschen
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)
Helium
Lissajous-Figur
Halo-Orbit
Zyklische Redundanzprüfung (CRC)
Inflation
Roger Penrose
Polarisation
Dunkle Materie
Dunkle Energie
XMM-Newton
RZ054 Space Elevator
Konzept und die mögliche Realisierung des Weltraumbahnhofs des 21. Jahrhunderts
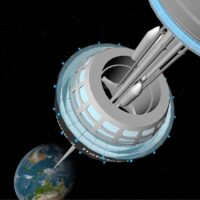
Doch eine Idee treibt die Wissenschaft von Anbeginn an um: was wäre, wenn man einen Fahrstuhl bauen könnte, der Material und Personen über ins All gespanntes Seil in die Höhe bringen könnte, das nur durch die Fliehkraft der Erde senkrecht über der Oberfläche steht? Die Beschränkungen der Raketenraumfahrt wären damit Geschichte, doch stellte das Konzept die Wissenschaft bislang noch vor unlösbare Herausforderungen.
Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels und es scheint, als ob wir uns einer Zeit nähern, in der die notwendigen Schlüsseltechnologien für einen Weltraumfahrstuhl langsam zusammen kommen. Dies würde dann in der Folge der Menschheit einen direkten Zugang zum All ermöglichen, die nahezu alle heutigen technischen Realitäten in eine neue Dimension überführen könnten.
Dauer:
1 Stunde
34 Minuten
Aufnahme:
05.06.2013

Markus Landgraf ESOC, ESA |
Shownotes
Themen
Intro — Vorstellung — Probleme der Raketenraumfahrt — Der Weltraumturm — Ein Seil aus dem Orbit — Ein Fahrstuhl ins All — Die Vision der Science Fiction — Das neue Material — Energie aus dem All — Fahrgeschwindigkeit — Inkrementeller Aufbau — Fahrstühle zu Bahnhöfen — Herausforderungen des Fahrstuhlbetriebs — Zerstörung des Seils — Wettereinflüsse — Bodenstation — Asteroiden — Internationale Aktivitäten — Zukünftige Nutzung
Links
Glossar
Weltraumlift
Gaia
Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski
Weltausstellung Paris 1889
Eiffelturm
Zentrifugalkraft
Schwerkraft
Umlaufbahn
Geosynchrone Umlaufbahn
Juri Nikolajewitsch Arzutanow
Jerome Pearson
Arthur C. Clarke
Fahrstuhl zu den Sternen
Kohlenstofffaser
Richard Buckminster Fuller
Geodätische Kuppel
Rauch
Fullerene
Kohlenstoffnanoröhre
Diamant
Graphen
Graphit
Chemische Gasphasenabscheidung (chemical vapour deposition)
Katalysator
Nickel
Space Tether
Rice University
Google X
Koronograf
Terrestrial Planet Finder
RZ053 Mythos Raumfahrt
Aufzeichnung des ersten Raumzeit Live on Stage Events vom 8. April 2013 in der Centralstation in Darmstadt

Thematisch haben wir dieses Mal einen anderen Weg genommen und einen unterhaltsamen Talk mit einem sehr breiten Ansatz angestrebt. Tim Pritlove sprach mit Rainer Kresken (ESA) und Volker Schmid (DLR) über den Mythos Raumfahrt, die Rolle der Science Fiction und über die kommenden Herausforderungen der Raumfahrt und Wissenschaft im Allgemeinen.
Das Event hat gezeigt, wie groß doch das Interesse an der Raumfahrt im allgemeinen und den Themen von Raumzeit im besonderen ist. Es war schön, so viele Hörer auf einmal zu treffen und für das vielfältige Feedback vor Ort bedanken wir uns auch ganz artig. Der Abend war ein großer Erfolg und wir hoffen, das zu gegebener Zeit ein mal wiederholen zu können.
Dauer:
1 Stunde
48 Minuten
Aufnahme:
08.04.2013

Rainer Kresken Flugdynamik, ESOC, ESA |

Volker Schmid Raumfahrtmanagement, DLR |
Volker Schmid ist für das DLR im Raumfahrtmanagement tätig und ist dort der Leiter der Fachgruppe für die Raumstation ISS. Privat ist er außerdem Science Fiction Autor und beschäftigt sich naturgemäß viel mit den fiktiven Parallelwelten und weiß, wo sich Erfundung und Realität nahestehen und wo sie immer noch weit von einander entfernt sind.
Dank unserem Hörer und Zuschauer SimSullen gibt es auch ein paar schöne Fotos vom Event, die ganz gut transportieren, wie diese Atmosphäre vor Ort war. Mehr Bilder gibt es in seinem Archiv.
Intro — Begrüßung — Rainer Kresken (ESA) — Volker Schmid — Die Reise zum Mond — Das Apollo-Programm und die Verschwörung — Die Welt nach der Mondlandung — Science Fiction, Raumfahrt und die Gesellschaft — Orion und das Hilton im All — Space Elevator — Neue Technologien — Leben auf anderen Planeten — Planck und die neuen Erkentnisse — Die Vermittelbarkeit von Raumfahrt Shownotes
Themen
Links
Glossar
Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
Alexander Gerst
ISS-Expedition 40
Atomic Clock Ensemble in Space
Raumschiff Enterprise
Raumpatrouille
Jules Verne
Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski
Sergei Pawlowitsch Koroljow
Isaac Asimov
Stanley Kubrick
Cape Canaveral
Baikonur
Kosmodrom Wostotschny
Plessezk
Sputnik
John F. Kennedy
Wernher von Braun
Apollo-Programm
The Beatles
Samantha Cristoforetti
Sigmund Jähn
Reinhold Ewald
Star Trek
Automated Transfer Vehicle (ATV)
Multi-Purpose Crew Vehicle (MPCV, Orion)
Weltraumlift
Fahrstuhl zu den Sternen (The Fountains of Paradise)
Arthur C. Clarke
Käsehobel
Weltraummüll
Magnetoplasmadynamischer Antrieb
Ad Astra Rocket Company
Ich, der Robot
2001: Odyssee im Weltraum
Kepler
Planck-Weltraumteleskop
Alpha-Magnet-Spektrometer
Dunkle Materie
Kosmischer Mikrowellenhintergrund
Sendeschluss
Lagrange-Punkte
Carl Sagan
Pale Blue Dot
RZ052 Solar Orbiter
Die ESA-Mission Solar Orbiter soll ab 2017 die Sonne erkunden
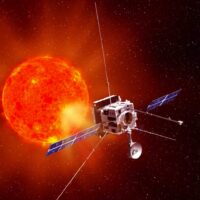
Solar Orbiter wird sich der Sonne auf Höhe des Merkurs annähern und in einer rotierenden, stark elliptischen Bahn zahlreiche Nah- und Fernuntersuchungen vornehmen.
Dauer:
1 Stunde
8 Minuten
Aufnahme:
18.01.2013

Paolo Ferri Bereichsleiter Missionsbetrieb, ESA |
Shownotes
Themen
Intro — Vorstellung — Persönlicher Hintergrund — Ausbildung — Komplexität der Raumfahrt — Lageregelung — Missionen zur Sonne — Zur Sonne fliegen — Flug des Solar Orbiter — Annäherung an die Sonne — Solarstationärer Flug — Kommunikation mit der Sonde — Dynamische Flugplanung — Ziele der Mission — Annäherung — Flug über die Pole — Laufende Veränderung der Umlaufbahn — Solarzyklus — Instrumente und Datenübermittlung — Kalibration — In-Situ-Instrumente — Fernerkundungsinstrumente — Übertragung und Zwischenspeicherung — Vorauswahl der Daten — Datenkompression — Verwendete Frequenzbänder — Planung des Starts — Verwendete Rakete — Zeitfenster — Troubleshooting — Kreativität bei der Problembehebung — Alptraum der Missionssteuerung — Missionsdauer
Links
RZ051 XMM-Newton
Das Röntgen-Weltraumteleskop XMM-Newton ist eine der erfolgreichsten und langlebigsten ESA-Missionen
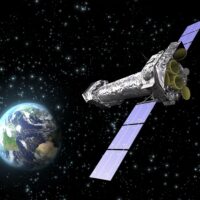
Mit Hilfe von XMM-Newton können Wissenschaftler mit sehr zielgerichtet und mit hoher Präzision ferne Sterne und Galaxien im Frequenzbereich der Röntgen-Strahlung untersuchen. Nachdem der Satellit ROSAT als Pionier der Röntgenastronomie eine Landkarte der Röntgenstrahlung im Universum geliefert hat, hebt XMM-Newton die Forschung in diesem Bereich auf eine neue Stufe.
Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet der für den Flugbetrieb von XMM-Newton zuständige Spacecraft Operations Manager Marcus Kirsch über Ziele und Aufgaben des Röntgen-Weltraumteleskops und erzählt auch von den großen Herausforderungen, vor dem das Team stand, als der Satellit einmal eine Woche nicht mehr zu erreichen war.
Dauer:
1 Stunde
16 Minuten
Aufnahme:
18.01.2013

Marcus Kirsch Spacecraft Operations Manager, ESA |
Shownotes
Themen
Intro — Vorstellung — Persönlicher Hintergrund — Ausbildung — XMM-Newton — Instrumente — Missionsziele — Interessante Objekte — Daten für die Wissenschaft — Announcement of Opportunity — Missionsverlauf und Lebensdauer — Start — Steuerung des Satelliten — Korrektur des Orbits — Kontaktverlust — Verlust der Verbindung — Problemsuche — Strategieentwicklung zur Wiedererlangung der Verbindung — Datenmaterial — Optische Beobachtung — Wissenschaftliche Erkenntnisse — Das Team
Links
Glossar
Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
Joachim Trümper
Eberhard Karls Universität Tübingen
XMM-Newton
ABRIXAS
Europäisches Weltraumastronomiezentrum
Röntgenastronomie
Uhuru
Matrjoschka
Doppelstern
Neutronenstern
Supernova
Krebsnebel
Supernova 1054
Galaxie
Schwarzes Loch
Ereignishorizont
Galaxienhaufen
Slew
Ariane 5
Cluster
Trägheitsrad
Herschel-Weltraumteleskop
ESTRACK
Spektroskopie
Gammablitz
Äther
RZ050 Humanoide Robotik
Anwendungsgebiete und Entwicklungsstand "menschenähnlicher" Roboter

Nachdem wir in Raumzeit #014 schon einmal auf die Anwendungsfelder in der Raumfahrt geschaut haben, wollen wir in der aktuellen Ausgabe die Robotik als Gesamtforschungsfeld betrachten - mit einem Schwerpunkt auf humanoide Roboter.
Dauer:
1 Stunde
43 Minuten
Aufnahme:
21.11.2012

Christoph Borst Leiter Abteilung Autonomie und Fernerkundung, Institut für Robotik und Mechatronik, DLR |
Shownotes
Themen
Intro — Vorstellung — Institut für Robotik — Persönlicher Hintergrund — Greifstrategien von Roboterhänden — Forschungsziele des Instituts — Search & Rescue — Akzeptanz von Robotern — Nachbildung menschlicher Körperfunktionen — Die Robotikplatform Justin — Intelligenz und Autonomie — Technische Eigenschaften von Justin — Anwendungsszenarien
Links
RZ049 Der Mars
Unser Nachbarplanet beantwortet der Wissenschaft viele Fragen und ist zu einem Lieblingsziel der Raumfahrt geworden.
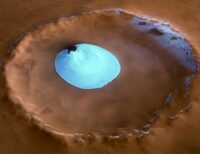
Heute weiß man, dass der Himmelskörper nicht nur Wasser in Form von Eis vorrätig hat, sondern auch vor nur wenigen hunderttausend Jahren und vielleicht sogar noch heute von geringen Mengen flüssigen Wassers geformt wurde. So kann die Wissenschaft mit der Erkundung des Mars viele Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems und auch der Erde zusammentragen.
Dauer:
1 Stunde
44 Minuten
Aufnahme:
02.10.2012

Ernst Hauber |
Podcast-Hinweis: in der Aufzählung der Missionen wurde die Phoenix-Mission leider übersehen.
Intro — Vorstellung — Bedeutung des Mars für die Forschung — Persönlicher Hintergrund — Das Bild des Mars im Wandel der Zeit — Das große Scheitern — Die Pathfinder Rover-Mission — Die Meteor-Studie zu Leben auf dem Mars — Mars Global Surveyor — Wasser auf dem Mars — Der schlummernde Riese — Mars Express — Die HRSC Stereokamera — Mars Reconnaisance Orbiter — Spirit und Opportunity — Mars Science Laboratory — Zukünftige Forschungsfelder Shownotes
Themen
Links
Glossar
Ludwig-Maximilians-Universität München
Percival Lowell
Mariner
Spektroskopie
Viking
Fobos
Seismograph
Mars Observer
Mars 96
Fobos-Grunt
Lunochod
Otto-Hahn-Institut für Chemie
Meteorit
Bakterien
Mars Global Surveyor
Basalt
Mars Polar Lander
Mars Surveyor
Mars Orbiter Camera
Erosionsrinne (Gully)
Schwemmkegel
Death-Valley-Nationalpark
Methan
Erdrotation
Phobos
Deimos
Jupiter
Flussdelta
Sulfate
Tonmineral
Lava
Mars Reconnaissance Orbiter
High Resolution Stereo Camera (HRSC)
Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM)
Thermal Emission Spectrometer (TES)
Hämatit
Spirit
Opportunity
Schichtsilikate
Mars Science Laboratory (MSL)
Alphapartikel-Röntgenspektrometer
Massenspektrometrie
Gale Crater
American Geophysical Union
ExoMars
Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)
RZ048 Mars Express
Die Raumsonde der ESA beobachtet und vermisst den Mars mit stereoskopischen Kameras und anderen Instrumenten
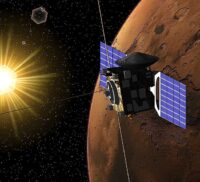
Besonders die hochauflösenden Stereobilder der HRSC-Kamera und die Bodenuntersuchungen des MARSIS-Radar-Instruments haben Aufmerksamkeit erregt und einen neuen Blick auf den der Erde so ähnlichen Himmelskörper erschlossen.
Dauer:
1 Stunde
21 Minuten
Aufnahme:
07.09.2012

Johannes Bauer |
Links:
- WP: Mars
- WP: Parabelflug
- Raumzeit: Der Parabelflug
- SpaceMaster
- WP: Kiruna
- Raumzeit: RZ045 Rexus/Bexus
- WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC)
- WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
- WP: Mars Science Laboratory
- WP: Rosetta
- Raumzeit: RZ024 Giotto und Rosetta
- Raumzeit: RZ046 Venus Express
- WP: Hohmannbahn
- ESA: Mars Express orbiter instruments
- WP: Phoenix
- WP: Beagle 2
- Raumzeit: RZ044 Der Merkur
- WP: Schwungrad
- WP: Impulserhaltungssatz
- WP: Sternsensor
- WP: Deep Space Network
- WP: Mars Reconnaissance Orbiter
- 2001 Mars Odyssey
- Dopplereffekt
- Mars Express
Shownotes
RZ047 Die Venus
Unser Nachbarplanet Venus ist zwar wenig erforscht, bietet aber viel Potential für wichtige Antworten

Obwohl die Venus außerhalb der habitablen Zone liegt, mag der Planet einmal die Voraussetzungen für Leben geboten haben. Aus diesem Grund ist die Venus für die Forschung auch besonders interessant: können Rückschlüsse auf eventuelle Folgen einer Erderwärmung gezogen werden?
Dem Planeten fehlen verschiedene Schutzmechanismen und Voraussetzungen, die auf der Erde Leben ermöglichen. Die Oberflächentemperatur von ungefähr 500 Grad Celsius und ein atmosphärischer Druck von 92 bar machen es schwierig, sich dem Planeten zu nähern. Bisher hat noch kein Landesystem mehr als ein paar Minuten auf der Vesus-Oberfläche überlebt.
Dauer:
1 Stunde
9 Minuten
Aufnahme:
07.09.2012

Jörn Helbert Experimentelle Planetenphysik, Institut für Planetenforschung, DLR |
Links:
- WP: Venus
- WP: Morgenstern
- DLR: Jörn Helbert
- Twitter Account von Jörn Helbert
- DLR: Institut für Planetenforschung: Experimentelle Planetenphysik
- WP: Technische Universität Braunschweig
- WP: Cluster
- WP: Mariner
- WP: Venera-Mission
- WP: Viking
- WP: Magellan
- WP: Venus Express
- Raumzeit: RZ046 Venus Express
- WP: Habitable Zone
- WP: Schwefelsäure
- Raumzeit: RZ039 Der Mond
- WP: Vulkanismus
- WP: Seismograph
- WP: Akatsuki (Venus Climate Orbiter)
- JAXA | Japan Aerospace Exploration Agency
Shownotes
RZ046 Venus Express
Die ESA-Mission zur Venus
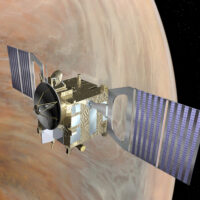
Um die wissenschaftliche Erkundung voranzubringen hat die ESA 2005 die Mission Venus Express gestartet, um mit einer Vielzahl an Instrumenten neue Daten und Erkenntnisse zu gewinnen. Venus Express baut auf für die Missionen Rosetta und Mars Express entwickelten Technologien auf und konnte daher in Rekordzeit auf die Beine gestellt werden: nur drei Jahre vergingen von der ersten Planung bis zum Start der Mission, die seit 2006 erfolgreich die Venus umrundet.
Dauer:
1 Stunde
36 Minuten
Aufnahme:
07.09.2012

Jörg Fischer Spacecraft Operations Engineer, ESOC, ESA |
Links:
- ESA: ESOC
- WP: Hipparcos
- WP: Cluster
- WP: Mars Express
- WP: Venus Express
- WP: Venus
- Raumzeit: RZ002 Missionsplanung
- Raumzeit: RZ043 BepiColombo
- WP: Planetary Fourier Spektrometer
- WP: ESA: Venus Express Instruments
- WP: Sojus
- ESA: ESTEC
- Raumzeit: RZ018 ESTEC Test Centre
- WP: Sternsensor
- WP: Das A-Team
- WP: Sonnenwind
- WP: Atmosphärenbremsung
Shownotes
RZ045 Rexus/Bexus
Das Weiterbildungsprogramm des DLR bietet Studenten einen einfachen Zugang zur Raumfahrt

Die Programme REXUS und BEXUS (Raketen- und Ballon-Experimente für Universitäts-Studenten) sind umfangreiche Kampagnen, in deren Rahmen Teams über einen Zeitraum von rund einem Jahr eigene wissenschaftliche und technische Experimente auf Höhenforschungsrakete und -Ballonen unter speziellen Atmosphärenbedingungen durchführen. Die Missionskampagnen bzw. -starts finden im Raumfahrtzentrum Esrange bei Kiruna in Schweden statt.
Das DLR begleitet und unterstützt die deutschen Teilnehmer während der gesamten Projektzeit, sodass hier auch über das eigene Experiment hinaus umfangreiche Kenntnisse - beispielsweise in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Raumfahrtagentur wie dem DLR - gewonnen werden können.
Dauer:
1 Stunde
45 Minuten
Aufnahme:
05.07.2012

Alexander Schmidt Mobile Raketenbasis, DLR |
Links:
- DLR: Mobile Raketenbasis (MORABA)
- DLR: Institut für Raumflugbetrieb und Astronautentraining
- RZ036 GSOC
- WP: Ludwig-Maximilians-Universität München
- WP: Post-Doktorant
- WP: Esrange
- WP: Andøya Rakettskytefelt
- WP: SHEFEX II
- WP: Stratosphäre
- WP: Mikrogravitation
- RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
- WP: Feststoffraketentriebwerk
- WP: Ammoniumperchlorat
- WP: Aluminium
- WP: Ariane 5
- RZ003 Raketenantriebe
- DLR: Standort Lampoldshausen
- WP: MIM-23 HAWK
- WP: Pirouette
- WP: Drehimpuls
- WP: Stabilisation
- WP: Zentrifugalkraft
- WP: TEXUS
- Swedish Space Corporation (SSC)
- Swedish National Space Board (SNSB)
- DLR: Standort Bremen
- WP: Planetesimal
- DLR: Raumfahrtagentur
- ESA: ESTEC
- WP: Bananenstecker
- WP: Samen
- REXUS/BEXUS – Rocket and Balloon Experiments for University Students
- REXUS User Manual
- BEXUS User Manual
- DLR: aktuelle Studenten-Ausschreibung REXUS/BEXUS
Shownotes
RZ044 Der Merkur
Der sonnennächste Planet unseres Sonnensystems ist noch voller Rätsel
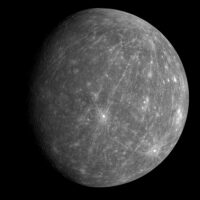
Anhand der Ergebnisse der bisherigen Missionen zeichnet sich bereits ein Bild ab, doch existieren verschiedene Theorien zu seiner Entstehung: Der Merkur - unserem Erdmond in Erscheinung und Gestalt recht ähnlich - ist vor allem von seiner großen Nähe zur Sonne geprägt. Dazu weist er eine Reihe von sonderbaren Eigenschaften auf, die die Planetenforschung umtreiben: ein merkwürdiges Magnetfeld, rätselhafte 'Löcher' auf der Oberfläche und einen ungewöhnlich großen Eisenkern.
Dauer:
1 Stunde
33 Minuten
Aufnahme:
08.08.2012

Tilman Spohn |
Links:
- DLR: Institut für Planetenforschung
- DLR: Tilman Spohn
- Mars Science Laboratory
- YouTube: Challenges of Getting to Mars: Curiosity’s Seven Minutes of Terror
- WP: High Resolution Stereo Camera (HRSC)
- WP: Mars Express
- WP: Rosetta
- WP: Terra incognita
- Raumzeit: RZ020 Giotto und Rosetta
- Raumzeit: RZ043 BepiColombo
- Raumzeit: RZ002 Missionsplanung
- WP: Potentialtopf
- WP: Giuseppe Colombo
- WP: Spin-Bahn-Kopplung
- WP: Neil Armstrong
- WP: Seismologie
- WP: Geophysik
- WP: University of California, Los Angeles (UCLA)
- WP: American Geophysical Union (AGU)
- WP: Westfälische Wilhelms-Universität
- WP: Universität Bern
- Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung
- Universität Granada
- DLR: BepiColombo Laser Altimeter (BELA)
- WP: Uranus
- WP: Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE)
- WP: Jupiter
- WP: Ganymed
- WP: MESSENGER
- WP: Hermes
- WP: Mariner
- WP: Dichte
- WP: Kant-Laplace-Theorie
- WP: Planetesimal
- WP: Erdmagnetfeld
- WP: T-Tauri-Stern
- WP: Dipol
- WP: Polarlicht
- WP: Kelvin
- WP: Regolith
- WP: Relaxation
- WP: Extrasolarer Planet
- WP: Kepler
- WP: Kepler-10b
- WP: CoRoT-7 b
- WP: COROT
- WP: Solar Orbiter
- WP: Euclid
Shownotes
RZ043 BepiColombo
Die ESA-Mission zum Merkur ist derzeit unterwegs und wird bald den Planeten neu erkunden
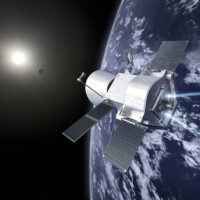
Trotzdem befinden sind die Vorbereitungen der ESA für die nächste Merkur-Mission BepiColombo auf der Zielgeraden, denn im August 2015 soll der Doppelsatellit (in Zusammenarbeit mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA) sich auf den langen Weg machen, um ab Januar 2022 den Merkur mit den modernsten Instrumenten zu untersuchen.
Dauer:
1 Stunde
23 Minuten
Aufnahme:
13.06.2012

Elsa Montagnon |
Links:
- ESA: Elsa Montagnon: „My life as a ‚SOM‘: Elsa Montagnon and her projects“
- WP: Maschinenbau
- RZ020 Rosetta und Giotto
- WP: Merkur
- WP: Mariner-10
- WP: MESSENGER
- WP: Astronomische Einheit (AU)
- WP: Sonnenwind
- WP: Magnetismus
- WP: Sputtern
- WP: Cassini-Huygens
- RZ030 Cassini-Huygens
- WP: Ariane 5
- WP: Centre Spatial Guyanais (Kourou)
- WP: Swing-by
- WP: Venus
- WP: Low Energy Transfer (Weak Stability Boundary)
- WP: Akatsuki
- WP: Wurfparabel
- WP: Ionenantrieb
- WP: Frequenzband
- WP: Venus Express
- WP: Mars Express
- WP: Radiator
- ESA Science & Technology: BepiColombo
- WP: Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC)
- ESA: ESAC
- DLR: BepiColombo Laser Altimeter (BELA)
- WP: Gammastrahlung
- RZ040 GOCE
- WP: Giuseppe Colombo
- Bodenstation
- ESA: ESTRACK trackings stations
- RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk
- RZ002 Missionsplanung
Shownotes
RZ042 Copernicus/GMES
Das Copernicus/GMES-Programm der ESA will die Erdbeobachtung revolutionieren
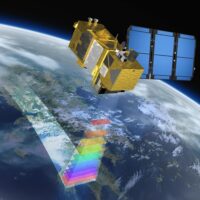
Neben der schnell zu schließenden Lücke in der Versorgung der wissenschaftlichen Forschung mit umfangreichen Messdaten, die durch das Missionsende des Envisat entstanden ist, öffnet GMES auch vollständig neue Anwendungsbereiche. Mehr als nur die Forschung soll auch die Gesellschaft und Wirtschaft von einer kontinuierlichen Versorgung zahlreicher Datenströme profitieren. Dabei geht GMES auch in der Zugänglichkeit der Daten selbst neue Wege und setzt erstmalig auf ein komplett freien Zugang.
Dauer:
1 Stunde
23 Minuten
Aufnahme:
12.06.2012

Josef Aschbacher Head of GMES Space Office, ESRIN, ESA |
Links:
- ESA: GMES
- WP: Global Monitoring for Environment and Security
- ESA: ESRIN
- WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut
- WP: European Remote Sensing Satellite (ERS)
- WP: Gemeinsame Forschungsstelle
- WP: Universität Innsbruck
- WP: Meteosat
- WP: Stickoxide (NOx)
- WP: Sentinel
- ESA: Envisat ASAR
- WP: COSMO-Skymed
- WP: Landsat
- WP: SPOT
- ESA: Envisat AATSR
- ESA: Envisat MERIS
- WP: Costa Concordia
- WP: Internationale Raumstation (ISS)
- WP: RADARSAT-2
- WP: Centre Spatial Guyanais
- WP: Sojus
- WP: Precision Farming
- WP: Galileo
- RZ037 Tandem-X
- RZ008 Satellitennavigation
- RZ035 Technology Transfer Program
- WP: OpenStreetMap
- GMES Masters
- ESA App Developer Camp
Shownotes
RZ041 Envisat
Der Satellit ENVISAT hat in seiner zehnjährigen Betriebszeit die Erdbeobachtung nachhaltig beeinflusst

Durch Envisat konnte erstmals ein umfangreiches Bild der Erde geschaffen werden und es wurde die Grundlage für die moderne Umweltforschung gelegt: Ozeanverschmutzung, Tropenwaldabholzung oder die Luftverschmutzung durch die Industrie - die hochentwickelten Instrumente an Bord des Satelliten lieferten vollkommen neue Einblicke in die globalen Auswirkungen unserer modernen Zivilisation.
Doch auch für die Vermessung der Erde und die wissenschaftliche Forschung im Allgemeinen war Envisat ein Durchbruch, konnte man mit ihm nun beobachten, wie sich Städte durch den U-Bahn-Bau um Zentimeter absenkten und ganze Länder durch Erdbeben um Meter verschoben. Envisat konnte Vulkanen beim "Atmen" zuschauen und erlaubte die Beobachtung des Ozonlochs. Die hohe Qualität der Daten eröffnete auch schrittweise den Weg von der wissenschaftlichen Forschung hin zu einer wissenschaftlichen Dienstleistung für die Welt.
Dauer:
1 Stunde
26 Minuten
Aufnahme:
12.06.2012

Michael Rast Head of Science Strategy, Coordination and Planning Office, ESRIN, ESA |
Links:
- WP: Envisat
- WP: ESRIN
- ESA: ESRIN
- WP: Vega
- WP: Geologie
- WP: Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)
- WP: Meteosat
- WP: European Remote Sensing Satellite
- WP: Radar
- WP: GOME
- WP: Synthetic Aperture Radar
- WP: Stereoskopie
- RZ006: Erdbeobachtung
- RZ037: Tandem-X
- WP: Saturn V
- WP: Dornier-Werke
- DLR
- RZ040 GOCE
- WP: Cluster
- WP: Artemis
- WP: Ionenantrieb
- ESA: Envisat ASAR
- WP: Elbehochwasser 2002
- DLR: Zentrum für Kriseninformation
- International Charter Space and Major Disasters
- Global Forest Resources Assessments
- RZ025 Zentrum für Kriseninformation
- WP: Tōhoku-Erdbeben 2011
- WP: Ätna
- ESA: Envisat GOMOS
- ESA: Envisat MIPAS
- ESA: Envisat SCIAMACHY
- WP: Atomemissionsspektrometrie
- WP: Aerosol
- WP: Kohlendioxid (CO2)
- WP: Methan
- WP: Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
- WP: Soil Moisture and Ocean Salinity Satellite (SMOS)
- ESA: SMOS
- EUMETSAT
- Meteosat
- ESA: Envisat MERIS
- WP: Imaging Spectrometer
- WP: Phytoplankton
- WP: Gelbstoff
- WP: Sedimentation
- WP: Algenblüte
- WP: Vegetation
- WP: Biolumineszenz
- WP: Thales Alenia Space
- WP: Verstärkung (Gain)
- ESA: Envisat Radar Altimeter RA-2
- WP: Gletscher
- WP: Permafrostboden
- WP: Nordwestpassage
- WP: Nordostpassage
- WP: Globale Erwärmung
- WP: El-Niño
- WP: La Niña
- WP: Ozonloch
- ATSR World Fire Atlas
- WP: RapidEye
- WP: Sentinel
Shownotes
RZ040 GOCE
Die Vermessung des Gravitationsfelds der Erde
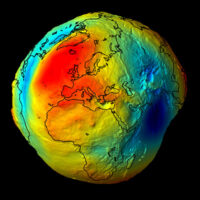
Dieses Gravitationsfeld allgemeingültig und mit einer bisher unerreichten Präzision zu vermessen ist die Aufgabe der Mission GOCE. Für den Satelliten wurde ein neuartiges Gravitations-Gradiometer zur Messung des Schwerefelds entwickelt und durch den Einsatz eines Ionenantriebs eine bisher unerreichte Bahnstabilität erreicht. Die Ergebnisse der Mission sind die Grundlage eines neuen geodätischen Referenzmodells auf dessen Basis andere Erdbeobachtungskonzepte miteinander kombiniert werden können.
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Prof. Reiner Rummel von der Technischen Universität München einerseits die Geschichte der Geodäsie, die Technik des Satelliten und die Aufgabenstellung der Mission und andererseits die Bedeutung der Messergebnisse für die Wissenschaft und die Gesellschaft. Dabei geht es auch um mögliche Auswirkungen von GOCE auf künftige Fernerkundungsmissionen zu Planeten und anderen Himmelskörpern.
Dauer:
1 Stunde
26 Minuten
Aufnahme:
11.06.2012

Reiner Rummel Technische Universität München |
Links:
- ESA: Reiner Rummel
- WP: Technische Universität München
- GOCE-Projektbüro Deutschland
- Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie
- WP: Geodäsie
- WP: Gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE)
- WP: Bill Kaula (Geophysik)
- Williamstown Report (1968) [PDF]
- WP: Very Long Baseline Interferometry
- WP: Teleskop
- Johann Jacob Bayer
- WP: Erdfigur
- Gravitation
- WP: Triangulation
- WP: Sputnik
- WP: Global Positioning System (GPS)
- WP: Geoid
- WP: Carl Friedrich Gauss
- WP: Isaac Newton
- WP: Royal Society
- WP: Académie française
- WP: Gravitationskonstante
- WP: Prisma
- WP: Atomuhr
- WP: Federwaage
- WP: Lagerstättenkunde
- WP: Freier Fall
- WP: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
- WP: Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE)
- WP: Erdatmosphäre
- WP: Sonnenwind
- WP: LAGEOS
- ESA: Living Planet Program
- WP: Golfstrom
- WP: Kuroshio
- WP: Corioliskraft
- WP: Alenia Aermacchi
- WP: Astrium
- WP: ONERA
- WP: Alcatel
- WP: CHAMP
- WP: Beschleunigungssensor
- WP: Gradiometrie
- WP: Gravimetrie
- WP: Elektrostatik
- WP: Platin
- WP: Radium
- WP: Ionenantrieb
- ESA: Drag-Free Propulsion System
- WP: LISA Pathfinder
- WP: Plessezk
- WP: Rockot
- WP: Sonnensynchrone Umlaufbahn
- WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC)
- WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
- WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut (ESRIN)
- Raumzeit: RZ018 ESTEC Test Centre
- WP: Alfred-Wegener-Institut
- WP: Antarktischer Zirkumpolarstrom
- WP: Tektonik
- WP: Vulkanismus
- WP: Meteorit
- WP: Himalayas
- WP: Tibet
- WP: Geophysik
- WP: Nivellement
- WP: Eurotunnel
- WP: Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL)
- Raumzeit: RZ039 Der Mond
- WP: Erdmantel
- WP: Konvektion
- WP: Magma
- WP: Hydrologie
Shownotes
RZ039 Der Mond
Über den Stand der Erkenntnis über unseren Erdtrabanten

Nach der explosiven Frühphase der Raumfahrt, die durch den Wettlauf zum Mond und letztlich den ersten erfolgreichen Besuch eines Menschen auf seiner Oberfläche gekennzeichnet war, ging das Interesse am Mond zunächst stark zurück. Erst in den letzten Jahren gibt es ein Wiederaufflammen des Interesses, geprägt vom bahnbrechenden Nachweis von Wasser auf dem Mond und der potentiellen Nützlichkeit des Trabanten für künftige Missionen in unser Solarsystem.
Dauer:
1 Stunde
16 Minuten
Aufnahme:
31.05.2012

Harald Hoffmann Institut für Planetenforschung, DLR |
Links:
- DLR: Harald Hoffmann
- DLR: Institut für Planetenforschung
- WP: Mond
- WP: Jules Verne
- WP: Von der Erde zum Mond
- WP: Galileo
- WP: Swing-by
- WP: Impakt
- WP: Einschlagkrater
- WP: Mondkrater
- WP: Nördlinger Ries
- WP: Steinheimer Becken
- WP: Erdmantel
- WP: Mineral
- WP: Luna-Programm
- WP: Apollo-Programm
- WP: Lunar Orbiter
- WP: Ranger
- WP: Surveyor
- WP: Saturn-Rakete
- WP: Mercury-Programm
- WP: Gemini-Programm
- WP: Apollo 1
- WP: Apollo 10
- WP: Apollo 11
- WP: Silicate
- WP: Ilmenit
- WP: Basalt
- WP: Magma
- WP: Pyroxengruppe
- WP: Präkambrium
- WP: Vulkanismus
- WP: Metalle der Seltenen Erden
- WP: Gezeitenkraft
- WP: Radon
- WP: Osmium
- WP: Regolith
- WP: Remanenz
- WP: Chandrayaan-1
- WP: Tycho
- Raumzeit: Der Parabelflug
- WP: Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL)
- WP: Clementine
- WP: Radar
- WP: Lunar Reconnaissance Orbiter
- WP: Sonnenwind
- WP: Vulkanisches Glas
- WP: Apatit
- WP: Helium
- WP: Kaguya
- WP: Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE)
- WP: SMART-1
- WP: Google Lunar X-Prize
- WP: Falcon 9
- WP: Dragon
- WP: SpaceX
- WP: Rover
- WP: Lunochod
- WP: BepiColombo
Shownotes
RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer
Über den Versuch an Bord der ISS den letzten Geheimnissen des Universums auf die Spur zu kommen
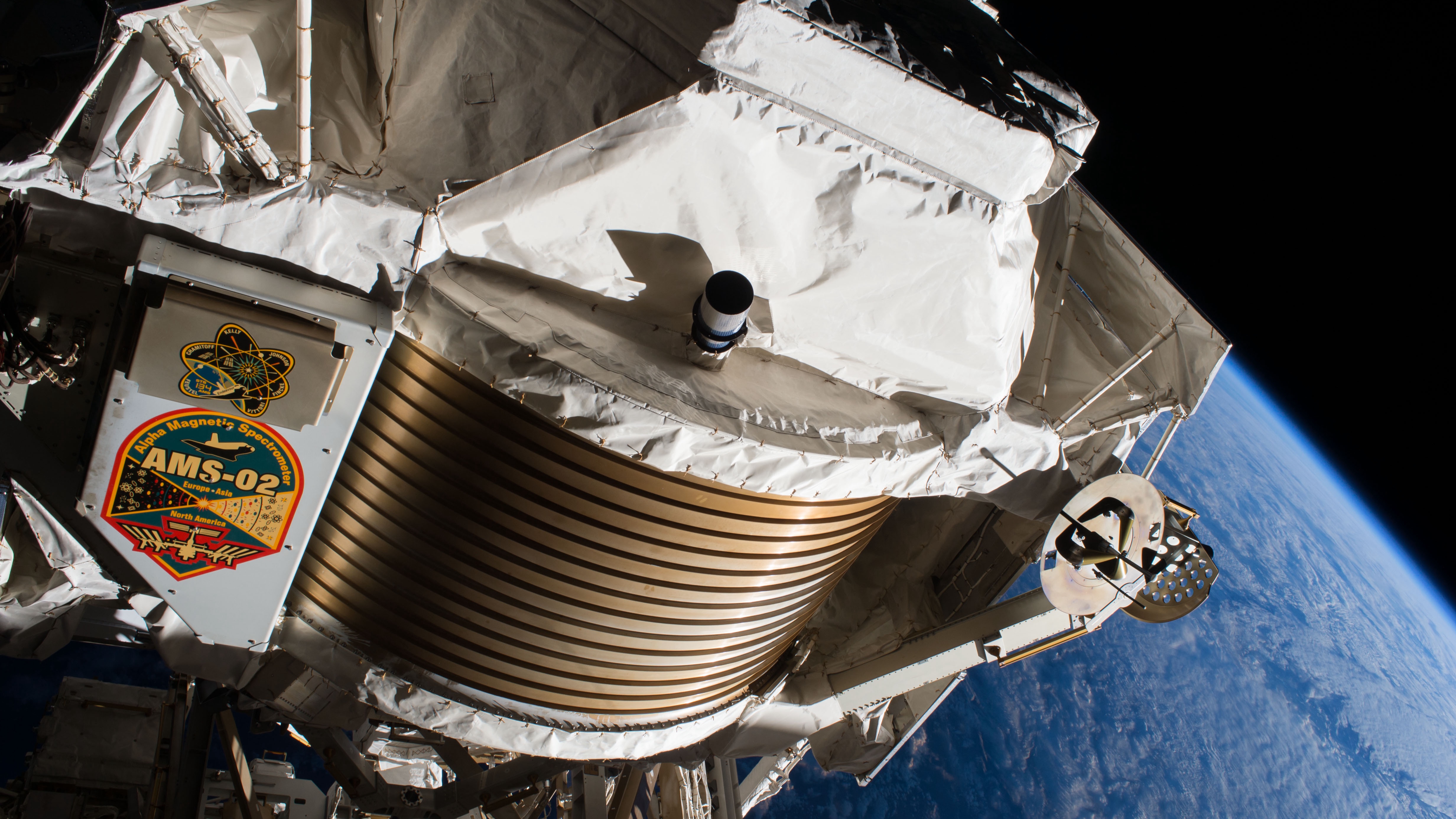
In den letzten zehn Jahren hat sich das Verständnis des Universums grundlegend gewandelt. Durch zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse wurden die bisherigen Annahmen auf den Kopf gestellt. Um die Fragen nach dem Wesen von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu beantworten müssen neue Wege gegangen werden. Dabei spielt das auf der Internationalen Raumstation installierte Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS) eine Schlüsselrolle.
Das vom DLR geförderte und von zahlreichen Wissenschaftlern in kurzer Zeit entwickelte neuartige Messsystem beobachtet und analysiert rund um die Uhr eintreffende kosmische Strahlung und sucht dabei nach Atomen und Elementarteilchen, die weiteren Aufschluss über die genaueren Umstände des Urknalls und der generellen Beschaffenheit des Universums geben sollen.
Dauer:
1 Stunde
59 Minuten
Aufnahme:
25.05.2012

Stefan Schael Leiter Lehrstuhl für Experimentalphysik, RWTH Aachen |
Links:
- WP: RWTH Aachen
- WP: Experimentalphysik
- WP: Exzellenzinitiative
- WP: Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS)
- WP: Werner Heisenberg
- WP: Paul Dirac
- WP: Wolfgang Pauli
- WP: Quantenmechanik
- WP: Albert Einstein
- WP: Allgemeine Relativitätstheorie
- WP: Gravitation
- WP: Max Planck
- WP: Plancksches Wirkungsquantum
- WP: Solarzelle
- WP: Transistor
- WP: Computer
- WP: Karl Popper
- WP: Verifizierung
- WP: Leuchtdiode
- WP: Michelson-Morley-Experiment
- WP: Lichtgeschwindigkeit
- WP: Hintergrundstrahlung
- WP: COBE
- WP: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)
- WP: Planck-Weltraumteleskop
- WP: Hubble-Weltraumteleskop
- WP: Bernhard Riemann
- WP: Dunke Materie
- WP: Fritz Zwicky
- WP: Urknall
- WP: Raumzeit
- WP: Kosmologische Konstante
- WP: Quantenfeldtheorie
- WP: Vakuumenergie
- WP: Äther
- WP: Dunkle Energie
- WP: Schwarzes Loch
- WP: Brauner Zwerg
- WP: Weißer Zwerg
- WP: Interstellares Medium
- WP: Neutrino
- WP: Baryonische Materie
- WP: Proton
- WP: Neutron
- WP: Baryon
- WP: Merkur
- WP: Pulsar
- WP: Large Hadron Collider (LHC)
- WP: Elementarteilchen
- WP: Kosmische Strahlung
- WP: Supernova
- WP: Aktiver galaktischer Kern
- WP: Victor Franz Hess
- WP: Samuel Chao Chung Ting
- WP: Charm-Quark
- WP: Photon
- WP: Antimaterie
- WP: Positron
- WP: Kohlenstoff
- WP: Magnet
- WP: Erdmagnetfeld
- WP: Dauermagnet
- WP: Metalle der Seltenen Erden
- WP: Gewölbe
- WP: Magnetisches Moment
- WP: ETH Zürich
- WP: Mir
- WP: Helium
- WP: Kathodenstrahlröhrenbildschirm
- WP: Elektronenvolt
- WP: Dielektrische Leitfähigkeit
- WP: Space Shuttle Endeavour
- WP: Mission STS-134
- WP: Sonnenfleck
- WP: Supraleiter
- WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum
- RZ018 ESTEC Test Centre
- WP: Super-Kamiokande
- WP: Kalibrierung
Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.
Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.
Shownotes
RZ037 TanDEM-X
Ein Tandem aus zwei parallel fliegenden Satelliten realisiert die bislang genaueste Beoabchtung der Erdoberfläche
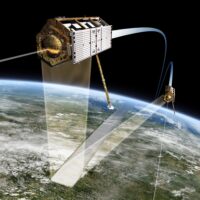
TanDEM-X ergänzt das erste Raumfahrzeug mit identischer Messtechnik, aber anders gelagerter Steuerung. Seit Oktober 2010 fliegen die beiden Systeme in helixförmiger Flugbahn um die Erde und kombinieren ihre Messergebnisse. Dadurch wird eine bislang nicht gekannte Genauigkeit in der Höhenmessung erzielt, die die Erdbeobachtung auf eine neue Basis stellt.
Dauer:
1 Stunde
20 Minuten
Aufnahme:
03.04.2012

Manfred Zink Projektleiter Bodensegment TanDEM-X-Mission, DLR |
Themen: SAR-Technik; Anwendungen von SAR; TerraSAR-X und TanDEM-X; die Helix-Flugbahn; Konzeption der TanDEM-X-Mission; Leistungsmerkmale von TanDEM-X; Umlaufzeiten und Energiemanagement; Radar-Messungen und Datenauswertung; Vorausplanung von Aufnahmen; Optimierung der Höhenmessung; Zeitsynchroner Satellitenbetrieb; Einfluss der Atmosphäre; Verfügbarkeit des Datenmaterials; Zukünftige Projektentwicklung; Bedeutung des Formationsflugs für die Raumfahrt; Zukünftige Optionen bei der Erdbeobachtung.
Links:
- WP: TanDEM-X
- DLR: TanDEM-X-Blog
- WP: Technische Universität Graz
- DLR: Standort Oberpfaffenhofen
- WP: Radar
- WP: Synthetic Aperture Radar (SAR)
- NASA: SIR-C/X
- WP: Space Shuttle
- WP: Envisat
- ESA: ESTEC
- DLR: TerraSAR-L
- WP: Frequenzband
- WP: Elektrodynamik
- WP: Apertur
- WP: Amplitude
- WP: Phase
- WP: Magellan
- RZ006 Erdbeobachtung
- DLR: Erdbeobachtung
- WP: TerraSAR-X
- DLR: TerraSAR-X
- WP: TanDEM-X
- DLR: TanDEM-X
- DLR: TanDEM-X-Bilder
- WP: Interferometrie
- WP: Umlaufbahn (Orbit)
- WP: Helix
- WP: Hydrazin
- WP: Stickstoff
- WP: Astrium
- WP: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
- WP: World Geodetic System 1984
- RZ025 Zentrum für Kriseninformation
- WP: Standardabweichung
- WP: Höhenmesser
- WP: ICESat
- WP: Prisma
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
- ESA: Sentinel-1
Shownotes
RZ036 Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum
Das GSOC in Oberpfaffenhoffen übernimmt viele wichtige Aufgaben der internationalen Raumfahrt

Das GSOC betreibt außerdem die Bodenstation des DLR in Weilheim und ist für die Steuerung der Lander-Mission der Rosetta-Raumsonde zuständig.
Dauer:
1 Stunde
40 Minuten
Aufnahme:
03.04.2012

Florian Sellmaier Wissenschaftlicher Mitarbeiter, GSOC |
Themen: Überblick GSOC; Aufgabenfelder des GSOC; die Columbus-Mission; Arbeitsteilung und Kommunikation; Multimissionsbetrieb; Ausbildung und Teamstruktur; Zeitplanung für Astronauten; Zukünftige Aufgaben; Herausforderung Weltraumschrott; European Proximity Operations Simulator; Robotische Exploration.
Links:
- DLR: GSOC
- Deutsches_Raumfahrt-Kontrollzentrum
- RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk
- DLR: Standort Weilheim
- WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
- WP: Centre national d’études spatiales (CNES)
- DLR: Standort Oberpfaffenhofen
- WP: Launch and Early Orbit Phase (LEOP)
- DLR: Standort Köln
- WP: Rosetta
- RZ020 Giotto und Rosetta
- WP: Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
- Internationale Raumstation (ISS)
- WP: Columbus
- Erdbeobachtung
- WP: TerraSAR-X
- WP: Galileo
- WP: Satellitenorbit
- Geosynchroner Orbit
- RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
- RZ010 Raumstationen
- NASA TV
- RZ017 Automated Transfer Vehicle (ATV)
- RZ011 Astronautenausbildung
- WP: Europäisches Astronautenzentrum
- DLR: DEOS
- RZ014 Robotik in der Raumfahrt
- RZ007 Weltraumschrott
- WP: Philae
- WP: Hayabusa 2
- JAXA: Hayabusa 2 Project
Shownotes
RZ035 Technology Transfer Program
Wie der Technologietransfer zwischen Raumfahrt und der Wirtschaft organisiert wird

Das Technology Transfer Program der ESA versucht genau diese Wechselwirkung anzustossen, die für beide Seiten außerordentlich hilfreich ist. Dazu kommen wertvolle Erkenntnisse der Raumfahrt so schneller in die wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Nutzung.
Dauer:
1 Stunde
9 Minuten
Aufnahme:
22.03.2012

Frank Salzgeber Leiter Technology Transfer Program, ESA |
Themen: Bedarf für Technologie-Transfer; das Technology Transfer Program in der ESA; Projektentwicklung; Erfolg und Misserfolg von Projekten; Business-Inkubations-Zentren der ESA; Der Innovations-Kreislauf; Aufgabenprofil und Struktur des TTP-Teams; Trends im Technologiebereich.
Links:
- ESA: Technology Transfer Program
- WP: Willy Messerschmitt
- WP: Raumgleiter Hermes
- WP: Deepwater Horizon
- WP: Mixed Pickles
- WP: Hitzeschild
- WP: Betriebsblindheit
- WP: Rettungsdecke
- WP: Magnetresonanztomographie
- ESA: ESA Business Incubation Centre Locations
- WP: Rabobank
- WP: Spirit
- WP: Opportunity
- WP: Cassini-Huygens
- RZ017 Automated Transfer Vehicle
- European Satellite Navigation Competition
- GMES Masters
Shownotes
RZ034 Space Situational Awareness
Die permanente Beobachtung der Erdumgebung sichert die Zukunft der Raumfahrt

Seit ein paar Jahren baut die ESA daher eines umfassendes System zur Beobachtung des Erdumfelds auf. Das Space Situational Awareness Program (SSA) fasst eine Vielzahl an Beobachtungsmethoden und -systemen in einem gemeinsamen Konzept zusammen, um in Echtzeit Entscheidungen über mögliche Objekt-Kollisionen im Orbit, mögliche Eintritte von Asteroiden in die Erdatmosphäre und den Einfluss des Weltraumwetters auf Missionen und Infrastrukturen treffen zu können.
Dauer:
1 Stunde
14 Minuten
Aufnahme:
22.03.2012

Detlef Koschny SSA-Programm, ESA |
Themen: Persönlicher Hintergrund; Weltraumwetter; Weltraumschrott; Erdnahe Objekte; Aufbau und Struktur SSA; Beteiligte Standorte; Datenformate; Bedrohung durch Asteroideneinschläge; Weltraumwetter; Gefahren auf der Erde durch Sonnenwind; Bedeutung von SSA für die Raumfahrt; internationale Kooperationen und alternative Beobachtungssysteme.
Links:
- ESA: Standort ESTEC
- RZ007 Weltraumschrott
- ESA: Space Situational Awareness
- Max-Planck-Institut für Sonnenforschung
- WP: Rosetta
- RZ020 Giotto und Rosetta
- WP: Komet
- WP: Asteroid
- WP: Meteor
- WP: Weltraumwetter
- WP: Protuberanz
- WP: Erdnahes Objekt
- WP: Chicxulub-Krater
- WP: Weltraumteleskop
- WP: Radar
- ESA: ESRIN
- WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut
- WP: Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC)
- WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum Darmstadt (ESOC)
- WP: GRAVES (Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale)
- WP: Tunguska-Ereignis
- WP: Wolfram Alpha
- RZ009 Asteroiden und Kometen
- WP: Asteroideneinschlag im Sudan 2008 (2008 TC3, Sudan-Event)
- WP: Asteroideneinschlag in Peru 2007
- WP: Meteosat
- WP: Polarlicht (Aurora Borealis)
- WP: Proba-2
- WP: Sonnenrotation
- WP: Sonnenfleck
- WP: Kernspeicher
- WP: Helios Raumsonde
- RZ014 Robotik in der Raumfahrt
- Inter-Agency Debris Coordination Committee (IADC)
- United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPOUS)
Shownotes
RZ033 Energie der Zukunft
Photovoltaik und Solarthermie bieten das Potential für einen umfassenden Umbau der Weltenergieversorgung

Doch für eine zuverlässige Energieversorgung, die den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft entspricht, kommt es auf eine kluge Kombination von unterschiedlichen erneuerbaren Energiequellen an. Studien des DLR zu einer Nutzung von Solarthermie und anderen erneuerbaren Energieformen und der Errichtung von speziellen Stromtrassen im Mittelmeerraum legten dabei in den vergangenen Jahren die Grundlagen für die DESERTEC-Initiativen, die einen umfassenden und kollektiven Umbau der Energie-Infrastruktur Europas, des Nahen Ostens und Nordafrikas (EUMENA-Region) zum Ziel haben.
Dauer:
1 Stunde
34 Minuten
Aufnahme:
07.03.2012

Franz Trieb Institut für technische Thermodynamik, DLR |
Themen: DLR Standort Stuttgart; Energieversorgung in der Raumfahrt; Anteil und Bedeutung enerneuerbarer Energien; Forschung des DLR im Bereich Erneuerbare Energien; Photovoltaik und Solarthermie; Speicherbare Energieträger; Stromübertragung; Dezentrale Stromversorgung durch Solarthermie; Die Studien des DLR; DESERTEC; Energie-Kooperation im Mittelmeerraum; Mögliche Kraftwerkkonzepte; Platzbedarf und Flexibilität solarthermischer Anlagen; Sicherheit der Energieversorgung.
Links:
- WP: Thermodynamik
- DLR: Institut für technische Thermodynamik
- WP: Sonnenenergie
- WP: Photovoltaik
- WP: Solarthermie
- WP: Frank Shuman
- WP: Biomasse
- WP: Technische Universität Clausthal
- WP: Energiespeicher
- WP: Erneuerbare-Energien-Gesetz
- WP: Elektroauto
- WP: Stromnetz
- WP: Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
- WP: Nikola Tesla
- WP: Thomas Alva Edison
- WP: Drei-Schluchten-Talsperre
- WP: Club of Rome
- DLR: TRANS-CSP Trans-Mediterranean interconnection for Concentrating Solar Power
- DLR: DESERTEC
- WP: Geothermie
- DESERTEC Foundation
- WP: Andasol
Shownotes
RZ032 Das Saturnsystem
Der Saturn und seine zahlreichen Monde bilden die Komplexität des Sonnensystems ab und bieten viele Überraschungen
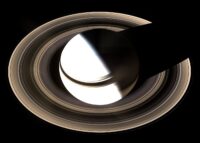
Dauer:
1 Stunde
46 Minuten
Aufnahme:
09.02.2012

Ralf Jaumann Institut für Planetenforschung, DLR |

Frank Sohl Institut für Planetenforschung, DLR |
Themen: Bedeutung der Saturn- und Jupitersysteme; Erkenntnislage vor der Cassini-Huygens Mission; Erkenntnisse durch Cassini-Huygens; Teilchenstrom im Saturnsystem; Enceladus und Kryovulkanismus; Monde und Ringe des Saturn; Benennung der Monde; Zusammensetzung der Gasmonde; Zusammensetzung von Saturn und Jupiter; Oberfläche und Atmosphäre des Titan; Innere Struktur des Titan; Methan-Ozeane; Spiegelreflektions-Beobachtung; Dünen aus Eis- und Gaskristallen; Stabilität des Saturn- und Solarsystems; Weiterer Ablauf der Cassini-Mission; Auswertung der Huygens-Mission; Übertragbarkeit der Titanforschung auf die Erde; Verbleibende Fragen der Wissenschaft.
Links:
- RZ030 Cassini-Huygens
- WP: Cassini-Huygens
- RZ005 Planetenforschung
- RZ009 Asteroiden und Kometen
- WP: Ralf Jaumann
- DLR: Institut für Planetenforschung
- DLR: Institut für Planetenforschung – Planetengeologie
- WP: Astrogeologie
- DLR: Institut für Planetenforschung – Planetenphysik
- Gezeitenkraft – Wikipedia
- WP: Saturn
- WP: Jupiter
- WP: Titan
- WP: Methan
- WP: Ethan
- WP: Ammoniak
- WP: Voyager 1
- WP: Voyager 2
- WP: Cassinische Teilung
- WP: Saturnringe
- WP: Spektroskopie
- WP: Schloss Neuschwanstein
- WP: Geysir
- WP: Enceladus
- WP: Kryovulkan
- WP: Silicate
- WP: Squash
- WP: MImas
- WP: Europa
- WP: Ganymed
- WP: Kallisto
- WP: Pluto
- WP: Zwergplanet
- WP: Asteroidengürtel
- WP: Pan
- WP: Juno
- WP: Wasserstoff
- WP: Helium
- WP: Methan
- WP: Ethan
- WP: Ontario Lacus
- WP: Kraken Mare
- WP: Argon
- WP: Merkur
- WP: Ceres
- WP: Dawn
- WP: Charon
- WP: Pluto Kuiper Express
- WP: Iapetus
- WP: Phoebe
Shownotes
RZ031 DLR_School_Labs
Schülerlabore bieten Schülern einen frühzeitigen technischen Zugang zu Luft- und Raumfahrt
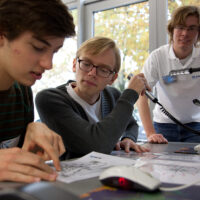
Dauer:
1 Stunde
8 Minuten
Aufnahme:
02.02.2012

Anke Kovar Leiterin DLR_School_Labs, DLR |
Themen: Überblick; DLR-Standort Braunschweig; Struktur und Ziele der DLR_School_Labs; Nachwuchsmangel das Bild des Wissenschaftlers in der Gesellschaft; Angebot für Schüler an den DLR_School_Labs; Kooperation mit den Schulen; Studie zur Auswirkung der DLR_School_Labs; Unterrichtskonzept und Team; Förderung und Finanzierung; Schülerlabore in Deutschland; Programm an den DLR_School_Labs; Evaluation und Feedback; Lehrerfortbildung und Unterrichtsmaterialien; DLR_next; Schwerpunkte der DLR_School_Labs; Beteiligung der Wissenschaftler an den Schülerlaboren; Wissenschaftliches Lernen in der Zukunft.
Links:
- DLR Standort Braunschweig
- WP: Meteorologie
- DLR_School_Labs
- Panorama: Virtueller Besuch im DLR_School_Lab
- DLR Dassault Falcon 20 E-5
- Raumzeit: RZ013 Die Atmosphäre
- WP: Wirbelschleppe
- DLR: Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik
- DLR: Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik
- WP: Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK)
- WP: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- DLR: Institut für Verkehrssystemtechnik
- DLR: Institut für Flugführung
- WP: Fahrerassistenzsystem
- WP: Autopilot
- WP: Flugzeugkollision von Überlingen
- DLR: Institut für Flugsystemtechnik
- WP: Area 51
- DLR: Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr
- WP: Technische Universität Dortmund
- WP: Technische Universität Hamburg-Harburg
- Lernort Labor
- WP: Fluglotse
- DLR: DLR_next
- Raumzeit: RZ003 Raketenantriebe
- Raumzeit: RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
Shownotes
RZ030 Cassini-Huygens
Der wagemutige Flug zum Saturnsystem und die Entdeckung der faszinierenden Welten des Titan

Cassini-Huygens ist eine Kooperation zweier Raumfahrtagenturen: Cassini (NASA) reiste gemeinsam mit der Sonde Huygens (ESA) zum Saturnsystem und setzte letztere über dem Saturnmond Titan ab. Der Eintritt von Huygens in die dichte Atmosphäre des Titan ist damit auch der erste Kontakt mit einem Himmelskörper unseres Sonnensystem, der trotz grundlegender Unterschiede auch frappierende Ähnlichkeiten mit unserer Erde aufweist.
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Michael Khan - Missionsanalytiker der ESA beim ESOC in Darmstadt - die Planung, Durchführung und Erkenntnisse dieser außergewöhnlichen Mission und berichtet von den zahlreichen Schwierigkeiten, die im Vorfeld und auch während des Fluges bewältigt werden mussten.
Dauer:
1 Stunde
48 Minuten
Aufnahme:
07.12.2011

Michael Khan Missionsanalyse, ESOC, ESA |
Themen: Einfluss der Mondlandung auf die Menschheit; Deep Space Missionen zum Jupiter; das Interesse am Saturnsystem; Lockvogel Titan; Beschluss zur Doppelmission Cassini-Huygens als Kooperation von NASA und ESA; Energieversorgung in sonnenlichtarmen Zonen; Cassini-Missionsplanung; Flug durch die Saturnringe; Instrumente an Bord von Cassini; Bordkamera; Spektrometer; Magnetometer; Detektion kosmischen Staubs; Entdeckung des flüssigen Ozeans auf dem Mond Enceladus; Methan-Welt Titan; Abtrennung von Huygens über dem Titan; Entdeckung eines Konstruktionsfehlers der Kommunikation zwischen Cassini und Huygens; Instrumente an Bord von Huygens; Messungen beim Eintritt in die Titan-Atmosphäre; Cassini-Huygens und die öffentliche Wahrnehmung; Fortsetzung der Cassini-Mission und künftige Missionen zu Jupiter und Saturn.
Links:
- WP: Cassini-Huygens
- ESA: Cassini-Huygens – Special auf Deutsch
- DLR: Cassini-Huygens
- ESA: ESOC Darmstadt
- WP: Mondlandung
- WP: ExoMars
- Michael Khan: Go For Launch
- WP: Saturn
- WP: Saturnmond Titan
- WP: Galileo
- WP: Jupiter
- WP: Orbiter
- WP: Lander
- WP: National Aeronautics and Space Administration (NASA)
- WP: Helios
- WP: Fobos-Grunt
- WP: Methan
- WP: Spektroskopie
- WP: Wasserstoff
- WP: Kohlenstoff
- WP: Venus
- WP: Radionuklidbatterie
- WP: Voyager-1
- WP: Mars Express
- WP: SMART-1
- WP: Titan-Rakete
- WP: Phoebe
- WP: Zentauren
- WP: Saturnringe
- WP: CCD-Sensor
- WP: Spektrometer
- WP: Spektrallinie
- WP: Chandrayaan-1
- WP: Enceladus
- WP: Serendipität
- WP: Magnetometer
- WP: Kryovulkan
- WP: Ganymed
- WP: Iapetus
- WP: Dopplereffekt
- WP: Frequenzband
- WP: Gaschromatographie
- WP: Massenspektrometrie
- WP: Radioteleskop
- WP: Signal-Rausch-Verhältnis
- WP: Interferometrie
- WP: Fluoreszenz
- WP: In weiter Ferne, so nah!
- WP: Eriesee
Shownotes
RZ029 Herschel-Weltraumteleskop
Per Infrarotstrahlung einen Blick in die entferntesten Ecken des Universums blicken
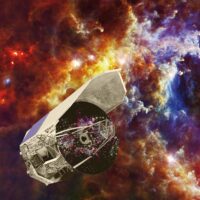
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Micha Schmidt, Spacecraft Operations Manager beim ESOC in Darmstadt, die Technik des Satelliten und schildert die besonderen technischen Anforderungen, die für dieses Projekt beachtet werden mussten.
Dauer:
1 Stunde
49 Minuten
Aufnahme:
23.11.2011

Micha Schmidt Spacecraft Operations Manager, ESOC, ESA |
Themen: Überblick zu Herschel; Persönlicher Hintergrund; Testsatellit der TU-Berlin; Vorgängerprojekt ISO; Anforderungen an ein Infrarot-Weltraumtelskop; Sonnenkollektoren und -schutzschild; Temperatur-Einflüsse von Erde und Sonne; Die Langrange-Punkte und die optimale Wahl der Umlaufbahn; Abstrahlungsprinzip zur Wärmeableitung; Vorteile einer erdumlaufsynchrone Umlaufbahn für tägliche Kommunikation; Gründe für die Doppelmission mit Planck; Technische Synergien von Herschel und Planck; Kommunikation mit der Bodenstation; Aufbau und Komponenten von Herschel; Präzision und Funktionsweise des Lageregelungssystems; On-Board-Data-Handling; Energieerzeugung und -verbrauch; Kühlung der Komponenten schon vor dem Start; Sicherung der Temperatur durch Einschluss in Kühltank; Start von Herschel und Planck; Wissenschaftliche Forschung mit Herschel; Erfolg des Projekts.
Links:
- ESA: Micha Schmidt
- RZ004 Operations
- ESA: Herschel und Planck
- WP: Herschel-Weltraumteleskop
- WP: TUBSAT-A
- WP: Arved Fuchs
- WP: Handsprechfunkgerät (Walkie-Talkie)
- WP: Infrared Space Observatory (ISO)
- ESA: Infrared Space Observatory
- WP: Langrange-Punkte
- WP: Lissajous-Figur
- WP: Halo-Orbit
- WP: Erdnähe (Perigäum/Apogäum)
- WP: Planck-Weltraumteleskop
- RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk
- WP: New Norcia Station
- WP: Cebreros Station
- WP: Kosmische Strahlung
- WP: Sonnenstrahlung
- WP: Erdmagnetfeld
- WP: Fehlertoleranz
- WP: Helium
- WP: RZ016 SOFIA Infrarotteleskop
- WP: Stabilisation (Lageregelung)
- WP: Kreisel
- WP: CCD-Sensor
- WP Peltier-Element
- WP: Sonnenwind
- WP: Spektroskopie
Shownotes
RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk
Ein internationales Geflecht aus Bodenstationen stellt die Kommunikation mit allen Raumfahrtzeugen sicher

Das ESTRACK Bodenstations-Netzwerk der ESA ist ein weltumspannender Verbund von Großantennen, die über internationale Datenleitungen vom ESOC in Darmstadt ferngesteuert werden. ESTRACK erlaubt eine Rund-um-die-Uhr-Beobachtung und Steuerung sowohl von erdnahen Starts und Missionen als auch die Fernkommunikation mit weit von der Erde entfernten Sonden und Weltraumteleskopen. Dabei unterstützt ESTRACK sowohl die ESA-eigenen Missionen als auch Projekte anderer Weltraumagenturen weltweit.
Dauer:
1 Stunde
42 Minuten
Aufnahme:
10.11.2011

Thomas Beck Leiter Ground Facilities Services Section, ESOC, ESA |
Themen: ESTRACK Bodenstationsnetzwerk; Steuer- und Kommunikationsbedarf mit erdnahen und erdfernen Missionen; eingesetzte Frequenzbänder; technische Ausstattung der Bodenstationen; Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen; Antennenstruktur; Das Fotomodell in Kourou; ESTRACK Netzwerkstruktur; Bandbreiten; Zentrale Steuerung und Automatisierung der Bodenstationen; Wartung und Problemlösung; Weiterleitung der Missionsdaten für die wissenschaftliche Auswertung; Bedrohungen durch Vögel, Mäuse, Schlangen und Waldbrände; Zuverlässigkeit der Bodenstationen; Standards für Protokolle und Datenformate für die Satellitenkommunikation; Kooperation mit und Hilfeleistungen für andere Weltraumagenturen; Andere Bodenstationsnetzwerke; Internationale Kooperation; Begleitung der Startphase durch das ESTRACK-Team; Teambuilding; Psychologische Belastung der Mitarbeiter; Unterstützung und Motivation durch die ESOC-Family; Ausbildung und Voraussetzungen für das ESTRACK-Team.
Links:
- ESA: Trainee Programm
- WP: ESTRACK
- ESA: ESTRACK Tracking Stations
- ESA: ESTRACK Control Centre
- WP: Telemetrie
- RZ008 Satellitennavigation
- WP: Gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE)
- WP: Erdbeobachtungssatellit
- WP: Kiruna
- ESA: Svalbard Tracking Station, Norwegen
- WP: Rosetta
- WP: Sonnensynchroner Orbit
- WP: Frequenzband
- ESA: Perth Station
- WP: Dopplereffekt
- WP: Kohärenz
- WP: Transponder
- RZ023 ROSAT
- RZ024 ROSAT Wiedereintritt
- ESA: Kourou Tracking Station
- ESA: ESAC Madrid, Spanien
- ESA: ESRIN Frascati, Italien
- ESA: Cebreros Deep Space Tracking Station
- WP: Beizjagd (Falknerei)
- WP: Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)
- ESA: ESTEC Nordwijk, Niederlande
- RZ018 ESTEC Test Centre
- WP: Centre national d’études spatiales (CNES)
- RZ004 Operations
Shownotes
RZ027 Mars500
Ein Langzeitstudie testet die psychischen Belastungen einer bemannten Marsmission in der Zukunft

Über einen Zeitraum von 520 Tagen wurde im Juni 2010 dabei ein Team von 6 Männern in einer Raumfahrzeug-ähnlichen Situation untergebracht und wird seitdem Tag und Nacht beobachtet und medizinisch-psychologischen Tests unterzogen. Während der langen Zeit werden möglichst viele Bedingungen eines realen Marsflugs simuliert. Im November 2011 endet das Experiment.
Dauer:
1 Stunde
29 Minuten
Aufnahme:
25.10.2011

Jennifer Ngo-Anh Life Science Department, ESTEC, ESA |
Themen: Persönlicher Hintergrund; Bedarf für medizinisch-psychlogische Studien für Langzeitmissionen; Erfahrungen durch Raumstationen und Mondflüge; Auswahl der Mars500-Teilnehmer; Module zur Simulation des Raumfahrtzeugs und der Marsoberfläche; Unterschiede zwischen Simulation und einer richtigen Mission; Einrichtung der Module; Sportprogramm für die Astronauten; Verzögerung der Kommunikation; Tagesplan; Wissenschaftliche Experimente an Bord; Veränderung bei Menschen in Isolation; Die Rolle der Betreuer und des simulierten Kontrollzentrums; Lustige Gruppenfotos und die Bedeutung von Humor und Kreativität für die Motivation; Kameraüberwachung an Bord; Simulierte Notfälle; wie man aufkommende Monotonie erkennt; Auswertung der medizinisch-psychlogischen Tests.
Links:
- ESA: ESTEC
- ESA: Mars500
- RZ021 Weltraumedizin
- RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
- WP: Internationale Raumstation (ISS)
- WP: Mir
- ESA: SPHINX
- Institut für Biomedizinische Probleme (IBMP)
- IBMP: Mars500
- RZ010 Raumstationen
- WP: Big Brother
- WP: 2001: Odyssee im Weltraum
Shownotes
RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
Falltürme, Höhenforschungsraketen und Parabelflugzeuge bieten Wissenschaftlern Alternativen zur und Vorbereitung für die Raumfahrt

Dauer:
2 Stunden
46 Minuten
Aufnahme:
14.10.2011

Ulrike Friedrich Forschung unter Weltraumbedingungen, Raumfahrt-Management, DLR |
Themen: Pflanzen und die Schwerkraft; Schwerelosigkeit durch freien Fall; Materialforschung; Falltürme; Forschungsraketen; Forschungssatelliten; Staub- und Plasmaforschung; Medizinische Forschung; Parabelflüge; Technische Einrichtungen im Flugzeug zur Unterstützung der Wissenschaftler; Steuerung des Parabelflugzeugs; Mikrogravitation; Geschichte der Parabelflüge; Vorbereitung und Auswahl der Experimente für einen Parabelflug; Parabelflüge als technische und organisatorische Vorbereitung für Raumfahrtmissionen; Medizinische Voraussetzungen zur Teilnahme am Parabelflug; Wo Parabelflüge durchgeführt werden können; das Safety Briefing; Vermeidung von Unwohlsein beim Flug; Kooperation mit Schulen; Ablauf eines Parabelflugs; Pullup-Phase; Einstieg in die Schwerelosigkeits-Phase; Simulation der Mond- und Marsgravitation; die Wirkung von Schwerelosigkeit auf den Körper; Verwirrung der sensorischen Wahrnehmung; Pullout-Phase; Astronautentraining auf Parabelflügen; Parabelflugtourismus; Wissenschaft und Kunst.
Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "duration"
Aufnahme: Oktober 2011
Links:
- DLR: Raumfahrtmanagement
- DLR: Forschung unter Weltraumbedingungen
- WP: Spacelab
- WP: Freier Fall
- WP: Parabelflug
- DLR: Parabelflüge
- DLR-Webcast: Parabelflüge
- WP: Internationale Raumstation
- WP: Fallturm
- DLR: Tempus – Tiegelfreies Elektromagnetisches Prozessieren unter Schwerelosigkeit
- WP: TEXUS
- DLR: TEXUS
- DLR: Deutsche Experimente auf russischen Forschungssatelliten: DLR und Roskosmos unterzeichnen Abkommen
- WP: Columbus
- WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
- WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- RZ021 Weltraummedizin
- DLR: Parabelflug
- DLR: Rundum-Panorama Parabelflug (Flash)
- WP: Airbus A300
- Novespace
- Mikrogravitation
- WP: Fritz Haber
- WP: Heinz Haber
- Youtube: Masten für Sonnensegel in Schwerelosigkeit getestet
- RZ014 Robotik in der Raumfahrt
- WP: Wasserflöhe
- WP: Sensory illusions in aviation
- RZ011 Astronautenausbildung
- WP: Samantha Cristoforetti
Shownotes
RZ025 Zentrum für Kriseninformation
Eine kleine Gruppe stellt die Raumfahrt rund um die Uhr in den Dienst der Katastrophenbekämpfung auf der Erde

Das ZKI ist rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres aktivierbar und ist in der Lage, in kurzer Zeit von den eigenen Satelliten oder auch denen anderer Organisationen Daten zu beziehen und diese der jeweiligen Hilfsanfrage gemäß auszuwerten, aufzubereiten und in strukturierter Form bereitzustellen. Das ZKI leistet damit eine signifikanten und hilfreichen Beitrag bei der Bekämpfung der Auswirkungen der Katastrophen.
Dauer:
1 Stunde
40 Minuten
Aufnahme:
07.10.2011

Tobias Schneiderhan |
Themen: Ziele und Aufgaben des ZKI; Anwendungsfälle für Kriseninformation; Beobachtung von Flüchtlingsströmen; Wie eine Datenermittlung ausgelöst wird; internationale Organisationen zur Krisenbekämpfung; Auswertung des Geländes durch Radarsatelliten; Vorher-Nachher-Vergleiche; Rollenverteilung im Team; Tsunami in Japan; Spezifierung der Aktivierung; Wer die Daten erhalten sollte; Erdbeben in Haiti; Einsatzplanung der Satelliten; Erkennen der Tsunamiauswirkungen auf dem Radarbild; Motivation und psychologische Belastung; Datenformate und Kompatibilität der Vergleichsdaten; OpenStreetMap und Crowdsourcing für Kriseninformationen; Aufgaben der einzelnen Teammitglieder; Verbesserung der Ergebnisse durch Ergebnisvergleich; Einsatz von Flugzeugen und Drohnen für die Informationsgewinnung; Verbindung zur Forschung im DLR.
Links:
- DLR: Tobias Schneiderhan
- DLR: ZKI Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation
- DLR: Earth Observation Center (EOC)
- DLR: Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum (DFD)
- DLR: Abteilung zivile Kriseninformation und Georisiken
- DLR: Institut für Methodik der Fernerkundung (IMF)
- DLR: Erdbeobachtung
- RZ006 Erdbeobachtung
- WP: Geographie
- WP: Fernerkundung
- German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS)
- International Charter Space and Major Disasters
- Services and Applications For Emergency Response (SAFER)
- WP: TerraSAR-X
- WP: TanDEM-X
- DLR: TanDEM-X im Video
- WP: Radar
- WP: Tōhoku-Erdbeben 2011
- Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
- Youtube: Tsunami-Frühwarnsystem
- Youtube: InaTEWS
- U.S. Geological Survey (USGS)
- RapidEye
- WP: Technisches Hilfswerk (THW)
- European Space Imaging
- WP: Tome, Japan
- DLR: TerraSAR-X-Satellitendaten zeigen Zerstörungen des Tsunamis in Japan
- DLR: Satellitenbilder des japanischen Katastrophengebiets
- WP: Erdbebem in Haiti 2010
- DLR: Wissenschaftler unterstützen Katastrophenhelfer nach dem Erdbeben auf Haiti
- DLR: Erdkrustenbewegungen in Haiti beim Erdbeben vom 12. Januar 2010
- WP: Geoinformationssystem (GIS)
- WP: Keyhole Markup Language
- WP: Google Earth
- WP: OpenStreetMap (OSM)
- YouTube: Progress of Openstreetmap Haïti coverage after 2010 earthquake
- WP: GEO-PICTURES
- SATID
- UNITAR’S Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT)
- WP: Kolontár-Dammbruch
- WP: Envisat
Shownotes
RZ024 ROSAT-Wiedereintritt
Die Vorbereitungen für das Wiedereintauchen des ausgedienten Satelliten ROSATs in die Erdatmosphäre
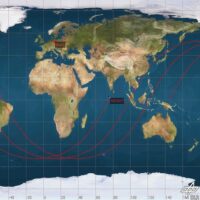
Rund um den Wiedereintritt gibt es viele Fragen, die wir in dieser Ausgabe behandeln möchten. Nach aktuellen Berechnungen steht der Wiedereintritt des ROSAT-Satelliten in die Erdatmosphäre für Ende Oktober 2011 an.
Dauer:
50 Minuten
Aufnahme:
29.09.2011

Manuel Metz Raumfahrtmanagement, DLR |
Themen: Weltraumschrott; Verlangsamung von Umlaufbahnen durch die Atmosphäre; Änderung des Abbremsverhaltens durch Sonneneinstrahlung; ursprünglicher ROSAT-Orbit; Zusammensetzung des ROSAT; Hitzebeständigkeit des ROSAT-Spiegels; Reentry-Kampagne des IADC; Berechnung des Absturzweges; Beobachtbarkeit des Satelliten; Verzögerungskräfte beim Eintritt in die Atmosphäre; Beständigkeit von Materialen und aufgefundene Überreste von Missionen.
Links:
- RZ: RZ023 ROSAT
- DLR: ROSAT
- DLR: FAQ ROSAT
- DLR: Der Wiedereintritt des Rosat-Satelliten und die Risiken
- DLR: Raumfahrtmanagement
- DLR: Institut für Technologie für Raumfahrtsysteme und Robotik
- ESA: Space Debris Office (ESOC)
- RZ007 Weltraumschrott
- WP: Sonnenwind
- WP: Ultraviolettstrahlung
- WP: Bahnneigung (Inklination)
- WP: Zerodur
- WP: Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK)
- WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
- WP: Technische Universität Braunschweig
- Inter-Agency Space Debris Coordination Committee
- Space Observation Radar TIRA
- DLR: Bodenstation Weilheim
- WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
- WP: Trajektorie
Shownotes
RZ023 ROSAT
Das Röntgenteleskop, dass die Röntgenastronomie revolutionierte
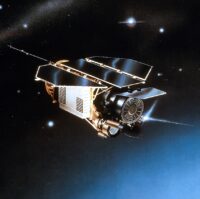
Dauer:
1 Stunde
55 Minuten
Aufnahme:
04.08.2011

Joachim Trümper Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
Themen: Persönlicher Hintergrund; Neutronensterne und die Geburt der Röntgenastronomie; Schwarze Löcher; Emssion von Röntgenstrahlung durch heißes Plasma; Voraussetzungen zur Detektion von Röntgenstrahlung; Experimente mit Höhenforschungsballonen; Beobachtung von Doppelsternsystemen; Erste Röntgensatelliten; Entwicklung von Röntgenteleskopen; Planung von ROSAT als Space-Shuttle-Mission; Start mit Delta-Rakete; Aufnahme des ROSAT-Betriebs; Erstellung einer Übersichtskarte; Zerstörung des primären Detektors durch Sonneneinstrahlung; Wissenschaftliche Erkenntnisse durch ROSAT; Beobachtung von Supernovae; Analyse der Röntgenstrahlung von Komenten; Hitzeverteilung im Universum; Beobachtung von Galaxienhaufen; Drohender Absturz des Satelliten; Fabrikation des ROSAT-Spiegels; Wissenschaftliche Studien auf Basis von ROSAT-Ergebnissen.
Links:
- Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik
- WP: Joachim Trümper
- MPE: Joachim Trümper
- DLR: Die ROSAT-Mission
- WP: Kernphysik
- WP: Pulsar
- WP: Neutronenstern
- WP: Astrophysik
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- WP: Eberhard Karls Universität Tübingen
- Institut für Astronomie und Astrophysik an der Universität Tübingen
- WP: Röntgenastronomie
- WP: Johannes Kepler
- WP: Höhenforschungsrakete
- WP: Gammaastronomie
- WP: Schwarzes Loch
- WP: Plasma
- WP: Hercules X1
- WP: Ricardo Giacconi
- WP: Mond
- WP: Aggregat 4 Rakete (V2)
- WP: Korona
- WP: Apollo
- WP: Sternbild Skorpion
- WP: Doppelstern
- WP: Scorpius X-1
- WP: Krebsnebel
- WP: Zyklotron
- WP: Tesla (Einheit)
- WP: Uhuru
- WP: National Aeronautics and Space Administration (NASA)
- WP: Supernova
- WP: Elektronenvolt
- WP: Proportionalzähler
- WP: Geigerzähler
- WP: Szintillationszähler
- WP: ROSAT
- WP: Ariel 5
- WP: Carl Zeiss
- WP: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMFT)
- WP: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- WP: High Energy Astronomy Observatory 2 (HEAO-2, Einstein-Observatorium)
- WP: Space Shuttle
- WP: STS-51 (Challenger-Katastrophe)
- WP: Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB)
- WP: Dornier-Werke
- WP: Delta-Rakete
- WP: Van-Allen-Strahlungsgürtel
- WP: Erdmagnetfeld
- WP: Bodenstation Weilheim
- WP: Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC)
- WP: Quasar
- WP: Galaxienhaufen
- WP: Rotverschiebung
- WP: Sonnenaktivität
- WP: Magnetischer Sturm
- WP: Koronales Loch
- WP: Weißer Zwerg
- WP: Supernova
- WP: Europäische Südsternwarte (ESO)
- WP: Lokale Gruppe
- WP: Komet
- WP: Sonnenwind
- WP: Milchstraße
- WP: Dunkle Materie
- Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik: eRosita
- WP: Dunkle Energie
- WP: Roskosmos
- WP: Zerodur
- WP: Bodensee
- DLR: Zum ROSAT-Wiedereintritt
- Heavons above: Aktuelle ROSAT-Position
Shownotes
RZ022 Advanced Concepts Team
Neue Konzepte und Ideen für die Raumfahrt denken

Um den weitergehenden Fortschritt zu ermöglichen und um Neues zumindest mental durchgespielt zu haben hat die ESA 2002 das Advanced Concepts Team (ACT) ins Leben gerufen. Im ACT entwickeln junge Wissenschaftler neuartige Konzepte, Lösungsansätze und Technologieideen die möglicherweiser künftigen Raumfahrtmissionen dienen können. Die Forschung ist hier allerdings bewusst nicht projektorientiert sondern wendet sich eher allgemeinen Problemen der Raumfahrt zu, um die Forschung von genau den Zwängen zu befreien, die sonst den Fortschritt behindern. Das Advanced Concepts Team arbeitet so als Think Tank für andere Bereiche der ESA.
Dauer:
2 Stunden
2 Minuten
Aufnahme:
02.09.2011

Leopold Summerer Advanced Concepts Team, ESTEC, ESA |
Themen: Gründung des ACT; Zielsetzung und Ansatz; Interdisziplinäre Zusammensetzung und Umfang des Teams; Kollaboration mit anderen ESA-Gruppen und Universitäten; Ariadna Kooperationsmodell; Abwehr von Asteroiden; Autonomes Landen; Wurzeln als Studienobjekt für extraterrestrische Exploration und wissenschaftliche Prozesse; Analyse von Pflanzenstengeln für die Materialforschung; Neuartige Antriebssysteme; Elektrische Triebwerke; Fusionstriebwerke; Neue Methoden der Bahnberechnung; Energiegewinnung im Weltraum für Missionen und die Erde; Kabellose Energieübertragung mit Laser oder Mikrowellen; Konzepte zur Entfernung von Weltraummüll; Weltraumschaum und Ionenbeschuss von Weltraumschrott; Das Einfangen des Aha-Effekts; Crowdsourcing; Open Source für Science Tools; ESA Summer of Code; Ausbildung und Karrierechancen im ACT.
Links:
- ESA: Advanced Concepts Team
- WP: Advanced Concepts Team
- WP: ESTEC
- Technische Universität Wien
- WP: Atomphysik
- ESA: Postdoctoral research fellowships
- WP: Disruptive Technologie
- WP: Clayton M. Christensen
- WP: Versuch und Irrtum (Trial and Error)
- ESA: Ariadna
- WP: Apophis
- RZ009 Asteroiden und Kometen
- WP: Bionik
- WP: Rosetta
- WP: Optischer Fluss
- WP: Guidance, Navigation and Control
- WP: Wurzel
- WP: Künstliche Intelligenz
- WP: Kollektive Intelligenz (Schwarmintelligenz)
- WP: Helicon Double Layer Thruster
- ESA: ESA accelerates towards a new space thruster
- WP: Electrically powered spacecraft propulsion
- WP: SMART-1
- WP: Ionenantrieb
- WP: Fusion Rocket
- WP: Global Optimization
- ESA: Global Trajectory Optimisation Competition (GTOC)
- RZ002 Missionsplanung
- WP: Jet Propulsion Laboratory
- WP: Centre national d’études spatiales (CNES)
- WP: Trajektorie
- WP: Voyager 1
- WP: Voyager 2
- Pioneer
- WP: Cassini-Huygens
- WP: Thermoelektrizität
- RZ020 Giotto und Rosetta
- WP: Photovoltaik
- WP: ExoMars
- WP: Desertec
- WP: Furoshiki
- ESA: Spider robots and the space web
- RZ007 Weltraumschrott
- WP: Brain-computer interface
- ESA: The Space Game
- Screencast: The Space Game Basic Tutorial
- ESA Summer of Code in Space 2011
Shownotes
RZ021 Weltraummedizin
Die Belastungen von Astronauten bei Raumflügen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Medizin im Weltraum

Eine der größten Herausforderungen in der bemannten Raumfahrt ist die Bewältigung der lebensfeindlichen Bedingungen des Weltraums: Schwerelosigkeit, künstliche Atmosphäre und kosmische Strahlung setzen dem menschlichen Körper in vielfältiger Weise zu und müssen sorgfältig bei jeder Mission mitbedacht werden. Eine medizinische Betreuung der Astronauten beginnt dabei bereits Monate vor dem Start und intensiviert sich während des Einsatzes noch einmal merklich.
Doch bietet die Raumfahrt der medizinischen Forschung auch ein großes Potenzial. Der Wegfall der Gravitation erlaubt das Isolieren und Studieren von Körperfunktionen wie es auf der Erde nicht möglich wäre. So trägt die Raumfahrtmedizin signifikant zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bei - auch weit über die Anforderungen und Bedingungen der Raumfahrt hinaus.
Dauer:
1 Stunde
27 Minuten
Aufnahme:
30.09.2011

Rupert Gerzer Leiter Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, DLR |
Links:
- DLR: Rupert Gerzer
- DLR: Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR
- Erdbeschleunigung
- Schwerelosigkeit
- Europäisches Astronautenzentrum (EAC)
- Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR
- Bettruhe
- RZ011 Astronautenausbildung
- DLR: Internationale Raumstation ISS
- Bemannter Marsflug
- Quarantäne
- Immunsystem
- Gleichgewichtsorgan
- Zentrifugalkraft
- Waleri Wladimirowitsch Poljakow
- Nierenstein
- Kalium
- Oxalate
- Herzinfarkt
- Antimikrobielle Substanz
- Strahlung
- Süddeutsche Zeitung: Strahlendosimetrie – Gefahr aus dem Weltraum
- Strahlenbiologie
- DLR: Forschungsanlage :envihab
- Ultraviolettstrahlung (UV)
- Skelett
- Supernova
- Proton
- Ion
- Exobiologie
- Mikroorganismus
- Reinraum
- Spore
Shownotes
RZ020 Giotto und Rosetta
Die wagemutigen Missionen zu den Kometen in unserem Sonnensystem

Die Raumsonde Rosetta ist nun auf dem Weg die Geschichte von Giotto fortzuschreiten und wird sich dem Komenten Tschurjumow-Gerasimenko nicht nur noch weiter nähern, sondern auch einen Lander auf dem Komenten absetzen, um dessen Zusammensetzung noch vor Ort zu analysieren. Im Juni wurde die Sonde in den Tiefschlaf versetzt um für die finale Phase der Mission in 2014 wieder geweckt zu werden.
Dauer:
1 Stunde
25 Minuten
Aufnahme:
20.05.2011

Gerhard Schwehm Rosetta Mission Manager / Head of Solar System Science Operations Division, ESA |
Themen: Entwicklung der Deep Space Missionen bei der ESA; Frühe Kometenforschung; Kometen-Hysterie; Berechnung der Flugbahn von Giotto und der retrograde Orbit; Begegnung mit Halley; Wissenschaftliche Auswertung; Geburt der Rosetta-Mission im Schatten der Challenger-Katastrophe; Giotto Extended Mission; Planung und Neuausrichtung der Rosetta-Mission; Flug zu Tschurjumow-Gerasimenko; Ankunft beim Kometen; Beobachtung und Vermessung der Oberfläche; Zielsetzung für den Komenten-Lander; das fliegende Labor; Energiemanagement und Lebensdauer; Hibernation und Wiedererweckung.
Links:
- ESA: Gerhard Schwehm
- WP: Universität des Saarlandes
- WP: Ruhr-Universität Bochum
- WP: Extraterrestrische Physik
- WP: Interplanetarer Staub
- ESA: ESTEC
- ESA: ESAC
- WP: International Ultraviolet Explorer
- WP: Stern von Betlehem
- WP: Pioneer
- WP: Voyager 1
- WP: Voyager 2
- ESA: Giotto
- WP: Giotto
- WP: Cassini-Huygens
- RZ005 Planetenforschung
- RZ009 Asteroiden und Kometen
- WP: Fred Whipple
- WP: Ludwig Biermann
- WP: Halleyscher Komet
- WP: Ariane 1
- WP: CCD-Sensor
- WP: CHON
- ESA: Horizon 2000
- ESA: Solar System Working Group
- WP: STS-51-L (Challenger-Katastrophe)
- WP: Grigg-Skjellerup
- WP: Swing-By (Gravity Assist)
- WP: Jupiter-Familie
- WP: Tschurjumow-Gerasimenko
- WP: Wild
- WP: Tempel 1
- WP: Enckescher Komet
- WP: Spektroskopie
- WP: Wirtanen
- RZ002 Missionsplanung
- WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
- WP: Capri
- WP: Philae (Rosetta Lander)
- WP: Sublimation
- WP: Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
Shownotes
RZ019 Space Shuttle
Ein Rückblick auf die Höhen und Tiefen des Space Shuttle Programms der NASA

Dauer:
1 Stunde
49 Minuten
Aufnahme:
27.06.2011

Volker Sobick Ehem. stellvertretender Leiter, Bemanntes Raumfahrtprogramm, DLR |
Themen: Deutsches Raumfahrtprogramm; Gründe für den Start des Shuttleprojekts; Technischer Aufbau der Shuttles; Stromversorgung für die Payload; Arbeiten mit der Nutzlast; die Buran; Wiedereintritt und der Wärmeschild des Space Shuttle; Strukturelle und technische Probleme, die zu den Challenger- und Columbia-Katastrophen führten; Maßnahmen zum Schutz des Programms; Landung des Shuttle; Spacelab und modulare Nutzlasten; Kooperation Deutschlands mit der NASA; Rettungssysteme; Seilbahn im Space Shuttle; die Zukunft der bemannten Raumfahrt bei der NASA; der Mond als Basis künftiger Missionen; Erlebnis eines Shuttle-Starts.
Links:
- WP: Space Shuttle
- DLR: Bemannte Raumfahrt, ISS und Exploration
- WP: ExoMars
- WP: Internationale Raumstation (ISS)
- WP: Spacelab
- WP: STS-51-L (Challenger-Katastrophe)
- RZ003 Raketenantriebe
- WP: Long Duration Exposure Facility
- RZ010 Raumstationen
- WP: Canadarm2
- WP: Buran
- WP: Orbital Maneuvering System
- WP: Borsilikatglas
- WP: Kohlenfaserverstärkter Kohlenstoff (RCC)
- RZ011 Astronautenausbildung
- WP: Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie (SOFIA)
- WP: Spacelab D1 (STS-61-A)
- WP: Spacelab D2 (STS55)
- WP: Ulf Merbold
- WP: Reinhard Furrer
- WP: Ernst Messerschmidt
- WP: Ulrich Walter
- WP: Hans Wilhelm Schlegel
- WP: Spacehab
- WP: Multi-Purpose Logistics Module
- WP: Leonardo MPLM
- WP: Raffaelo MPLM
- WP: Christoph Kolumbus
- WP: Augeninnendruck
- WP: Osteoporose
- WP: SpaceX
- WP: Falcon
- WP: Ares
- WP: Mondbasis Alpha 1
Shownotes
RZ018 ESTEC Test Centre
Die zentrale Qualitätssicherung aller ESA-Missionen in den Niederlanden

Dauer:
1 Stunde
30 Minuten
Aufnahme:
10.05.2011

Jörg Wehner Chef Technisches Netzwerks der ESA-Zentren in Europa |
Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Jörg Wehner, Chef des Technischen Netzwerks der ESA-Zentren in Europa, die einzelnen Einrichtungen des Test Centres, welche Eigenschaften der Raumfahrzeuge wie getestet werden und welche Bedeutung das Testen im Gesamtprozess der Raumfahrt bei der ESA einnimmt.
Themen: ESTEC Test Centre; Bau und Planung von Satelliten; Produktionszeiträume und der Fortschritt der Technologie; Individuelle Tests und die Übertragbarkeit auf Produktionsserien; Rettung der Herschel-Mission auf Basis von Testergebnissen; Testeinrichtungen des Zentrums; Simulation des Raketenstarts mit Vibration und Schall; die Akustiktestkammer; Messung der Belastungen in der Rakete durch Sensoren; Aufbau und Struktur des Rütteltischs; Simulation des Weltraums durch Temperatur und Vakuum; Sonnenlichtsimulation; Abkühlung und Hochtemperaturbelastungen im Weltraumsimulator; Drehung der Satelliten; der Einfluss des Elektromagnetismus und die elektromagnetischen Kompatibilitätstests; Weitertransport nach Kourou oder Baikonur;
Links:
- ESA: ESTEC Test Centre
- ESA: ESRIN Frascati
- RZ017 Automated Transfer Vehicle
- WP: Internationale Raumstation
- WP: Mikrogravitation
- WP: CryoSat
- WP: Herschel-Weltraumteleskop
- WP: Planck-Weltraumteleskop
- WP: Galileo
- WP: Astrium
- WP: Thales Alenia Space
- WP: Envisat
- WP: Horn
- WP: Airbus
- WP: Hydropneumatik
- WP: Merkur
- WP: BepiColombo
- WP: CERN
- WP: Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)
Shownotes
RZ017 Automated Transfer Vehicle
Das vollautomatische Raumfahrzeug der ESA setzt neue Standards im Raumflug

Dauer:
1 Stunde
35 Minuten
Aufnahme:
11.05.2011

Nico Dettmann ATV Program Department Head, ESTEC, ESA |
Themen: Gase und Treibstoffe; Dry Cargo; Lageregelung der ISS; andere ISS-Versorgungsfahrzeuge; Dockingsysteme; Collision Avoidance Maneuver; Escape Maneuver; Automatischer Betrieb in Abstimmung mit dem Kontrollzentrum; Start mit der Ariane und die Startphase im Orbit; die mehrstufige Annäherungsphase an die ISS; Docking; russisches und amerikanisches Wasser; Überwachung der Massepositionen bei Ein- und Ausladen; Abdocken von der ISS; kontrollierter Wiedereintritt; künftige ATV-Missionen.
Links:
- ESA: ESTEC
- ESA: Automated Transfer Vehicle
- WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
- WP: Space Shuttle
- WP: Sojus
- WP: Progress
- WP: H-2_Transfer_Vehicle (HTV)
- WP: Commercial Orbital Transportation Services (CRS)
- WP: SpaceX
- WP: Orbital Sciences Corporation
- WP: Falcon 9
- WP: Dragon Capsule
- WP: Columbus
- ESA: „Jules Verne demonstrates flawless Collision Avoidance Manoeuvre“
- WP: Johannes Kepler ATV
- WP: Jules Verne ATV
- WP: Ariane 5 ES ATV
- WP: GTO
- WP: LEO
- WP: Perigäum, Apogäum
- WP: Bahnneigung (Inklination)
- WP: Global Positioning System
Shownotes
RZ016 SOFIA Infrarotteleskop
Das fliegende Weltraumteleskop ermöglicht kurzfristige und ungewöhnliche Beobachtungen des Weltalls

Dauer:
2 Stunden
41 Minuten
Aufnahme:
06.05.2011

Alois Himmes Projektleiter SOFIA, DLR |
Themen: Gründe für flugzeuggestützte Weltraumbeobachtung; Teleskopie in verschiedenen Wellenbereichen; Infrarot-Teleskopie; Auswertung des Lichtspektrums zur Bestimmung der Zusammensetzung stellarer Objekte; Beobachtung einer Sterngeburt; Hintergrundstrahlung des Urknalls und weit entfernter Galaxien; das erste Flugzeugobservatorium: Kuiper Airborne Observatory (KAO); Kalibration der Beobachtungsinstrumente; Vorteile eines luftgestützten Observatoriums; Forschungsergebnisse des KAO; Beobachtung dunkler Objekte durch „Bedeckung“ anderer Sterne; Planung des Umbaus des SOFIA-Flugzeugs; Ausgleich der Vibrationen durch Lagerung; Optimale Flughöhen und die spezielle Eignung der Boeing 747SP für das Projekt; die DLR-NASA-Kooperation zum Bau und Betrieb von SOFIA; die Ersatzteilproblematik; Konstruktion und Herstellung des Teleskopspiegels; Teamstärke; Planung der Flugstrecke; Verlauf eines Messfluges; Automatische Echtzeit-Nachführung des Teleskop zum Ausgleich der Flugbewegung; Deutsches Sofia-Institut und die Zusammenarbeit mit dem akademischen und schulischen Bereich; arbeitskulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und den USA.
Links:
- WP: SOFIA
- DLR: SOFIA-Themenseite
- NASA: SOFIA
- DLR: SOFIA im Video
- DLR: SOFIA-Blog
- DLR: Bericht eines wissenschaftlichen SOFIA-Flugs
- Youtube: Eindrücke eines Wissenschaftsflugs auf SOFIA
- WP: James Webb Space Telescope
- WP: Herschel-Weltraumteleskop
- WP: Strahltriebwerk
- WP: Polarlicht
- WP: Heeresversuchsanstalt
- WP: Spektralfarbe
- WP: Spektrallinie
- WP: Kohlenstoffmonoxid
- WP: Wärme
- WP: Hintergrundstrahlung
- WP: Arno Penzias
- WP: Robert Woodrow Wilson
- WP: Urknall
- WP: Kuiper Airborne Observatory
- WP: Spektrometer
- WP: Polarimeter
- WP: Ames Research Center
- WP: Infrared Astronomical Satellite
- WP: Infrared Space Observatory
- WP: Spitzer-Weltraumteleskop
- WP: Boeing 747SP
- WP: Charles Lindbergh
- WP: Hantel
- Youtube: Öffnen der Cavity-Door
- Youtube: Animation SOFIA
- WP: Gasdruckfeder
- WP: Tropopause
- WP: High Altitude and Long Range Research Aircraft
- WP: Lockheed U-2
- WP: Lockheed F-104 („Starfighter“)
- WP: Airbus A380
- WP: Carl Zeiss
- WP: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- WP: Faser-Kunststoff-Verbund
- WP: Monocoque
- WP: Ceran
- WP: Zerodur
- WP: Europäische Südsternwarte (European Southern Observatory, ESO)
- WP: CCD-Sensor
- WP: Vertikalwinkel (Elevation)
- WP: Azimut
- WP: Faserkreisel
- WP: Winkelsekunde (Bogensekunde)
- Youtube: Video 1: SOFIA-Flugzeug wackelt um das unbewegte Teleskop herum
- Youtube: Video 2: SOFIA-Flugzeug wackelt um das unbewegte Teleskop herum
- DSI: Deutsches SOFIA-Institut
- WP: Universität Stuttgart
- WP: Silithiumcarbid
- DLR: SOFIA-Infos DLR-Raumfahrtmanagement
- USRA: SOFIA Science Center
- MPIfR: Max-Planck-Institut für Radioastronomie
- Uni Köln: GREAT
Shownotes
RZ015 Softwaretechnik
Softwareentwicklung und ihre Unterstützung für Betrieb und Simulation
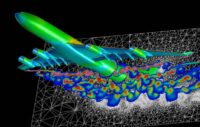
Dauer:
1 Stunde
11 Minuten
Aufnahme:
04.05.2011

Andreas Schreiber Institut Simulations- und Softwaretechnik, DLR |
Themen: Aufgaben des Instituts für Simulations- und Softwaretechnik; Anforderungsanalyse; Bug Tracker; Testgetriebene Entwicklung; Programmiersprachenvielfalt; Versionskontrolle; Datenmanagement; die Bedeutung von Open Source für die Forschung; Integrierte Entwicklungsumgebungen; Telemedizin; Open Source Entwicklung; Freie Lizenzen; Technologiemarketing; Ausbildung.
Links:
- DLR: Andreas Schreiber
- DLR: Institut Simulations- und Softwaretechnik
- DLR: Abteilung Verteilte Systeme und Komponentensoftware
- WP: Softwaretechnik
- WP: Anforderungserhebung
- WP: Bugtracker
- WP: Fortran
- WP: C
- WP: Python
- WP: Testgetriebene Entwicklung
- WP: Modultest (Unit Test)
- WP: Java
- WP: C++
- WP: C#
- WP: MATLAB
- WP: Perl
- WP: Tcl
- WP: Concurrent Versions System (CVS)
- WP: Apache Subversion
- WP: Mercurial
- WP: Intranet
- RZ006 Erdbeobachtung
- WP: Eclipse
- WP OSGi
- WP: Telemedizin
- WP: WebDAV
- catacomb
- DLR: Data Finder
- Launchpad
- DLR Technologiemarketing
- WP: Apache-Lizenz
- WP: Wissensmanagement
- ApacheCon
- FrOSCon
Shownotes
RZ014 Robotik in der Raumfahrt
Erste Missionen und die mögliche Zukunft robotischer Anlagen in Raumfahrzeugen
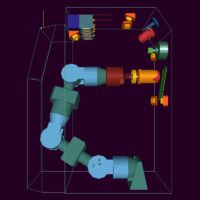
Dauer:
2 Stunden
Aufnahme:
25.03.2011

Klaus Landzettel Institut für Robotik und Mechatronik, DLR |
Themen: Alte Computer; Entwicklung der Robotik in den letzten 40 Jahren; Manipulatoren; analoge Robotersteuerung; Sensorsysteme; erster Einsatz eines Roboterarms in einem Space Shuttle; Roboterarm-Fernsteuerung vom Boden; Einflüsse auf Mechanik und Elektronik im Weltraum: Belastung durch den Start, Wärmeabfuhr ohne Atmosphäre, Radioaktive Strahlung, fehlende Schwerkraft; Sechs Sekunden Unendlichkeit; wie man in der Schwerelosigkeit einen Würfel einfängt; Kollaboration von Menschen und Robotersystemen; Kräne und Robotikexperimente auf der ISS; Robotik zur Bekämpfung von Weltraumschrott; Anfliegen bestehender Satelliten; wie man einen Satelliten einfängt; Unterstützung durch Robotik bei Weltraumspaziergängen; Flugkorrektur von fehlgestarteten Satelliten; Laufzeitverlängerung von geostationären Satelliten durch externe Antriebssysteme; Automatisches Andocken im Apogäumsmotor; Echtzeitsteuerung und Telepräsenz von Robotern auf der ISS; Roboter unter Einfluss von Radioaktivität.
Links:
- DLR: Klaus Landzettel
- WP: Dreiphasenwechselstrom
- WP: Lochkarte
- WP: Lochstreifen
- WP: Wechselplattenlaufwerk
- WP: PDP-11
- WP: Manipulator
- WP: Koordinatentransformation
- WP: Kartesisches Koordinatensystem
- WP: Inverse Kinematik
- WP: Parallelverschiebung (Translation)
- WP: Rotation
- WP: Sensor
- WP: Kraftmessung
- WP: Laser
- WP: Triangulation
- WP: STS-61-A (D1-Mission)
- WP: Spacelab
- WP: STS-55 (D2-Mission)
- WP: Columbia
- WP: Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)
- WP: White Sands Test Facility
- WP: Drahtgittermodell
- WP: Bajonettverschluss
- WP: Schwingtisch (Rütteltisch)
- WP: Konvektion
- WP: Latch-Up-Effekt
- DLR: ROTEX – Robot Technology Experiment on Spacelab D2-Mission
- WP: Dornier-Werke
- WP: Intel 8086
- WP: Intel 8087
- WP: Aktorik
- WP: Rover
- RZ011 Astronautenausbildung
- WP: Canadarm2
- WP: European Robotic Arm
- WP: Robonaut
- RZ007 Weltraumschrott
- DLR: EPOS – Abschleppdienst im All
- WP: Kesslersyndrom
- WP: Lidar
- WP: Radar
- WP: Drehmoment
- WP: Progress
- WP: Apogäumsmotor
- WP: TV-SAT
- DLR: Orbital Life Extension Vehicle (OLEV)
- WP: Ionenantrieb
- WP: Xenon
- WP: Geostationäre Transferbahn
- WP: Elektrolytkondensator
- WP: Tantal-Elektrolytkondensator
- DLR: ROKVISS
- DLR: Bodenstation Weilheim
- WP: Nuklearkatastrophe von Fukushima
- DLR: SpaceMouse
- WP: Anti-Aliasing
Shownotes
RZ013 Die Atmosphäre
Erforschung des wichtigsten Bereichs der Erde für Leben und Raumfahrt

Dauer:
1 Stunde
26 Minuten
Aufnahme:
27.03.2011

Bernadett Weinzierl Institut für Physik der Atmosphäre, DLR |
Themen: Institut für Physik der Atmosphäre; Aufbau der Atmosphäre; Ozonschicht; Spurengase; Aerosole; Beitrag der Aerosole zur Klimaerwärmung; Vulkanasche und der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island; die Gefährdung des Flugverkehrs durch vulkanische Asche; das Forschungsflugzeug Falcon des DLR; Warnsysteme für Folgenabschätzung von Vulkanasche; Internationale Messflüge; Vorbereitung des Forschungsflugzeugs für neue Missionen; Ergebnisse der Messung der Eyjafjallajökull-Aschewolke; der Flug über den Vulkan; Waldbrände; Belastung der Atmosphäre durch den Schiffsverkehr; Einfluss von Aerosolen auf die Wolkenbildung; die Wirkung der Industrieabgase auf die Farbe der Wolken; historische CO2-Messungen und die Entdeckung der menschengemachten globalen Erwärmung.
Links:
- DLR: Dr.rer.nat. Bernadett Weinzierl
- DLR: Daten aus der Ascheschicht für die nächsten zwei Jahre / Atmosphärenforscherin Dr. Bernadett Weinzierl untersucht Auswirkung auf das Klima
- DLR: Institut für Physik der Atmosphäre
- DLR: Standort Oberpfaffenhofen
- DLR: Sonderseite Vulkanaschewolke
- DLR: Ergebnisse der Vulkanasche-Messflüge
- WP: Ludwig-Maximilians-Universität München
- WP: Lidar
- WP: Meteorologie
- RZ006 Erdbeobachtung
- WP: Erdatmosphäre
- WP: Ionosphäre
- WP: Neutrosphäre
- WP: Troposphäre
- WP: Tropopause
- WP: Stratosphäre
- WP: Ozon
- WP: Ozonschicht
- WP: Stratopause
- WP: Mesosphäre
- WP: Mesopause
- WP: Thermosphäre
- WP: Thermopause
- WP: Exosphäre
- WP: Aerosol
- WP: Ruß
- WP: Staub
- WP: Sulfate
- WP: Sauerstoff
- WP: Stickstoff
- WP: Spurengase
- WP: Distickstoffmonoxid (Lachgas)
- WP: Methan
- WP: Permafrostboden
- WP: Sahara
- WP: Ärmelkanal
- WP: Bodenerosion
- WP: Vulkanausbruch
- WP: Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010
- WP: Pinatubo
- WP: Vulkanische Asche
- DLR: Forschungsflugzeug Falcon
- WP: Dassault Falcon 20
- WP: Volcanic Ash Advisory Center (VAAC)
- WP: Waldbrand
- WP: Boreale Zone
- WP: Meersalz
- WP: Waldsterben
- WP: Saurer Regen
- WP: Schwefeldioxid
- WP: Globale Erwärmung
- WP: Eisbohrkern
Shownotes
RZ012 Sigmund Jähn
Ein Rückblick auf 50 Jahre bemannter Raumfahrt mit dem ersten deutschen Raumfahrer

17 Jahre später wurde ein Deutscher Teil einer dieser Missionen: Der Wissenschaftler und Militärpilot Sigmund Jähn aus Morgenröthe-Rautenkranz in Sachsen trat am 26. August 1978 die Reise zur Raumstation Saljut 6 an und war damit der erste Deutsche im Weltall. Nach der Wende wurde Sigmund Jähn zu einem begehrten Ratgeber des DLR und der ESA sowie Ausbilder deutscher Astronauten. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der bemannten Raumfahrt baten wir Sigmund Jähn, einen Rückblick auf die Pioniertage der Raumfahrt zu wagen.
Dauer:
1 Stunde
29 Minuten
Aufnahme:
02.03.2011

Sigmund Jähn |
Themen: Berufung als Kosmonaut; Saljut-Raumstationen; die Raumfahrtforschung der DDR; Militärflugzeuge und Raumfahrzeuge; Ausbildung; kulturelle und technische Unterschiede zwischen der östlichen und der westlichen Raumfahrt; die Raumfahrt als Vorbild für die Kooperation der Menschheit; Erfolge und Misserfolge früher Missionen; Juri Gagarins Absturz; Gefahren und Vorsichtsmassnahmen in der Raumfahrt; Entwicklung der Internationalen Zusammenarbeit; Marsflüge.
Links:
- WP: Juri Alexejewitsch Gagarin
- WP: Sigmund Jähn
- WP: Interkosmos
- DLR: Zur Geschichte der Raumfahrt in der DDR
- WP: Spektrometer
- WP: Nationale Volksarmee
- WP: Apollo-Programm
- WP: Skylab
- WP: Saljut
- WP: Saturn-Rakete
- WP: Proton-Rakete
- WP: Space Shuttle
- WP: Hitzeschild
- WP: MiG-29
- WP: MiG-17
- WP: Ulf Merbold
- WP: Gravitationskonstante
- WP: Sternenstädtchen
- RZ010 Raumstationen
- WP: Sergei Pawlowitsch Koroljow
- WP: Wernher von Braun
- WP: Weltraumtourismus
- WP: Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski
- WP: Herrmann Oberth
- WP: Jules Verne
- WP: A4
- WP: Letzter Flug des Space Shuttle Challenger
- WP: Letzter Flug des Space Shuttle Columbia
- WP: Mars-500
Shownotes
RZ011 Astronautenausbildung
Eine anspruchsvolle Erarbeitung von Wissen, Fähigkeiten und Konditionen ebnet den Weg ins All

Dauer:
1 Stunde
32 Minuten
Aufnahme:
22.03.2011

Samantha Cristoforetti Astronautin, ESA |
Themenliste: Auswahlverfahren für Astronauten; Die Ausbildungszentren und das Prinzip der verteilten Ausbildung; Training für Außenbordeinsätze; Bedienung von robotischen Systemen; das Erlernen der Schwerelosigkeit; Kommunikation mit der Bodenstation; Eurocom; das Üben von Notfällen und vom Umgang mit schwierigen Situationen; Training für die ISS; Tätigkeiten zwischen Grundausbildung und Raumeinsatz; Teamarbeit, Kritik und Vertrauen; Überlebenstraining im Falle von Notlandungen.
Links:
- WP: Samantha Cristoforetti
- ESA: Samantha Cristoforetti
- WP: Isaac Asimov
- WP: Star Trek
- WP: Trekkie
- WP: Convention
- Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, TU München
- WP: Luftwaffenakademie Pozzuoli
- WP: AMX
- ESA: Alexander Gerst
- ESA: Thomas Pesquet
- ESA: Andy Mogenson
- ESA: Timothy Peak
- ESA: Luca Permitano
- WP: European Astronaut Centre (EAC)
- WP: Sojus
- WP: Außenbordeinsatz (EVA)
- WP: Internationale Raumstation (ISS)
- WP: Columbus-Modul
- WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
- WP: Swjosdny Gorodok (Sternenstädtchen)
- WP: Canadarm2
- WP: Canadian Space Agency (CSA)
- WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- WP: Kibō
- H-2 Transfer Vehicle (HTV)
- WP: Archimedisches Prinzip
- WP: Parabelflug
- Novespace
- DLR: Microgravity User Support Center
- Paolo Nespoli
- ESA: André Kuipers
- ESA: Roberto Vittori
- WP: Space Shuttle
- WP: Fiat 500
- WP: Iglu
Shownotes
RZ010 Raumstationen
Von den ersten russischen Raumstationen bis zur Internationalen Raumstation ISS

Dauer:
2 Stunden
38 Minuten
Aufnahme:
24.02.2011

Reinhold Ewald Columbus Control Center, ESA |
Themenliste: Wie man Astronaut wird; Einfluss von Literatur und Filmen; Traum Raumstation; Die Saljut-Raumstationen; Koppeln und Docken; Sojus und Space Shuttle als Basistechnologien zum Bau der ISS; Vorbereitung der Astronauten für den Raumstation-Aufenthalt; wie man eine Toilette für das All konzipiert; Struktur und Module der Mir; Start zur Raumstation und das Frieren im Weltall; spartanische Ausstattung der Raumkapsel; Betreten der Raumstation; Metallgeruch und die Bedeutung des Luftreinigungssystem; Feuer an Bord; Notruf über Amateurfunk; der Beginn der amerikanisch-russischen Zusammenarbeit; Schwerelosigkeit und warum eine Raumstation sich stets im freien Fall befindet; Experimente in der Schwerelosigkeit; Astronauten als Versuchskaninchen und medizinische Erkenntnisse aus der Forschung im All; Struktur und Module der ISS; Beiträge der einzelnen Partnerorganisationen zur ISS; Stromerzeugung an Bord; Stabilisierung der Raumstation durch Kreisel; Versorgung der ISS durch Raumtransporter; Standards für Einbaugeräte; die Module der ISS; das Columbus-Forschungslabor der ESA; Herausforderungen für die ISS nach dem Missionsende des Space Shuttle; ATV als Alternative zur Sojus; Besatzung der ISS; warum die ISS keine Gravitation durch Zentrifugen erzeugen kann; Internet auf der ISS; Tagesablauf eines ISS-Astronauten und die Zusammenarbeit mit dem Kontrollzentrum; Frauen im Weltall; Psychologische Aspekte des Langzeitaufenthalts an Bord; Zukunft der ISS und zukünftige Raumstationen.
Links:
- WP: Raumstation
- WP: Reinhold Ewald
- WP: Internationale Raumstation (ISS)
- ESA: Human Spaceflight and Exploration
- DLR: Internationale Raumstation (ISS)
- WP: Radioastronomie
- WP: Raumfahrer
- DLR: Deutsche Astronauten
- WP: Klaus-Dietrich Flade
- WP: Hans Wilhelm Schlegel
- WP: Spacelab
- DLR: Spacelab-Mission
- WP: Mondlandung
- WP: 2001: Odyssee im Weltraum
- WP: Raumpatrouille
- WP: An der schönen blauen Donau
- WP: Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski
- WP: Hermann Oberth
- WP: Saljut
- WP: Mir
- WP: Sojus
- WP: Space Shuttle
- ESA: Online-Special: ATV
- ESA: ATV-Blog
- WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
- WP: Apollo-Sojus-Test-Projekt
- WP: Inertialraum
- WP: Periskop
- WP: Sergei Konstantinowitsch Krikaljow
- WP: STS-55 (Spacelab-Mission D-2)
- WP: Columbia
- WP: STS-107 (Columbia-Absturz)
- WP: Thomas Reiter
- DLR: Thomas Reiter – 350 Tage im All
- WP: Moonlight Serenade
- WP: Amateurfunkdienst
- WP: Kamtschatka
- WP: Kohlenstoffmonoxid
- WP: Asbest
- WP: Kohlenstoffdioxid
- WP: Röntgenstrahlung
- WP: Gravitation
- WP: Schwerelosigkeit
- WP: Parabelflug
- DLR: Parabelflüge
- WP: Fallturm
- WP: Freier Fall
- WP: Konvektion
- WP: Kristall
- WP: Diffusion
- WP: Subkutis
- WP: Osteoporose
- ESA: ESA Fakten und Zahlen
- WP: Europäische Weltraumorganisation (ESA)
- WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- WP: Canadian Space Agency (CSA)
- WP: Kreisel
- WP: Drehimpuls
- WP: Progress
- WP: Raumtransporter
- WP: Sarja (FGB)
- WP: Swesda
- WP: Unity
- WP: Destiny
- WP: Mikrogravitation
- WP: Biowissenschaften
- WP: International Standard Payload Rack
- WP: Harmony
- ESA: Online-Special: Columbus-Experimente
- WP: Columbus
- ESA: Paolo Nespoli bei Twitter
- WP: Paolo Nespoli
- WP: Kibō
- WP: Léopold Eyharts
- WP: Frank De Winne
- WP: Tranquility
- WP: Mare Tranquillitatis
- ESA: Node-3 and Cupola
- WP: Cupola
- WP: H-2 Transfer Vehicle (HTV)
- WP: Star Wars
- WP: Dark Star
- WP: Artemis
- WP: Mark Shuttleworth
- WP: Zentrifugalkraft
- WP: The Wizard of Oz
- WP: Zentrifuge
- WP: Remote-Desktop
- WP: IP-Telefonie
- WP: Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS)
- WP: Fluid Science Laboratory
- WP: Mars-Rover
- WP: Apollo 13
Shownotes
RZ009 Asteroiden und Kometen
Die Trabanten unseres Sonnensystem bergen Erkenntnisse und Gefahren für die Menschheit

Dauer:
1 Stunde
49 Minuten
Aufnahme:
08.02.2011

Alan Harris Institut für Planetenforschung, DLR |
Themen: Asteroiden und Kometen; der Asteroidenhauptgürtel; Einfluss des Jupiters; Einschlagswahrscheinlichkeiten von Asteroiden auf Himmelskörpern und der Erde; Krater auf der Erde; potentielle Gefährdung der Erde durch Erdnahe Asteroiden; der Asteroid Apophis; Auswirkung der Gravitation der Erde auf Asteroiden; Ablenkmanöver für Asteroiden; Gefahr für Satelliten; Maßnahmen zur Bekämpfung eines drohenden Asteroideneinschlags: Erkundungsmissionen, Explosionen, Massetorpedos; Bedeutung von Asteroiden für die Entstehung von Leben; Laufende und geplante Missionen zu Asteroiden; Entstehung von Asteroiden-Monden.
Links:
- Alan Harris
- RZ005 Planetenforschung
- WP: Queen’s University Belfast
- WP: University of Leeds
- WP: Infrarot-Strahlung
- Rutherford Appleton Laboratory
- WP: Röntgen
- WP: ROSAT
- WP: Max-Planck-Institut für Astrophysik
- WP: Weltraumteleskope
- WP: Herschel-Weltraumteleskop
- WP: Spitzer-Weltraumteleskop
- WP: Transneptunisches Objekt
- WP: Erdnaher Asteroid
- WP: Asteroid
- WP: Asteroids
- WP: Asteroidengürtel
- WP: Gravitation (Schwerkraft)
- WP: Astronomische Einheit
- WP: Zentrifugalkraft
- WP: Komet
- WP: Jupiter
- WP: Apsis
- WP: Sonnenwind
- WP: Spektroskopie
- WP: Spektrallinie
- WP: Absorptionsbande
- WP: Meteor
- WP: Meteorid
- WP: Barringer-Krater
- WP: Shoemaker-Levy 9
- WP: Mond
- WP: Tsunami
- WP: Asteroid Apophis
- WP: Chicxulub-Krater
- WP: Kreide-Tertiär-Grenze
- WP: Exobiologie
- WP: Geologie
- WP: Aminosäuren
- WP: Mars
- WP: Extrasolarer Planet
- ESA: Marco Polo
- WP: Marco Polo
- WP: Spektralklasse
- WP: Asteroid spectral types
- WP: C-type Asteroid
- WP: S-type Asteroid
- WP: M-type Asteroid
- WP: Eisen
- WP: Nickel
- WP: Radar
- WP: Zwergplanet Ceres
- WP: Pallas
- WP: Vesta
- WP: Planetesimal
- WP: Mission Dawn
- NASA: Osiris Rex
- WP: Drehmoment
Shownotes
RZ008 Satellitennavigation
Die technische Basis moderner Ortungssysteme von GPS bis Galileo
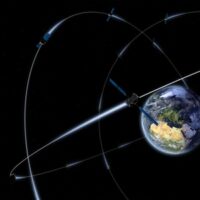
Dauer:
1 Stunde
53 Minuten
Aufnahme:
14.12.2010

Felix Antreich Institut für Kommunikation und Navigation, DLR |
Themen: Ausbildung; Technische Voraussetzung zum Aufbau eines Satellitennavigationsnetzes; GPS; Intelligenz eines Navigationssatelliten; Kommunikation mit den Bodenstationen; Abstrahlungswinkel der Satelliten; Zeit- und Positionssynchronisation; Berechnung der Position im Empfänger; Einfluss der Atmosphäre; Navigations-Kaltstart und der Almanach; Assisted GPS; Differential GPS; D-GPS für Flughäfen; Satellitengestütze Korrektursysteme; EGNOS; Ausbau von GPS; Galileo und die Gründe für ein europäisches Navigationssystem; Systemintegrität; Geplante Genauigkeit von Galileo; Aufbauphase von Galileo; Kompatibilität und gleichzeitige Nutzung von Galileo, GPS und GLONASS; Anwendungen von Galileo; Hochpräzise GPS-Empfänger mit Mehrantennensystemen für urbane Umgebungen und im Wald; Empfängertypen bei Galileo; Dienstkategorien von Galileo; Navigation von Satelliten durch Satellitennavigation; Navigation auf dem Mond.
Links:
- DLR: Standort Oberpfaffenhofen
- DLR: Institut für Kommunikation und Navigation
- WP: Sextant
- WP: Globales Navigationssatellitensystem
- WP: Interkontinentalrakete
- WP: Selective Availability
- WP: Global Positioning System
- WP: Zeit
- WP: Sichtverbindung
- WP: Navigationssatellit
- WP: Frequenzspreizung
- WP: Codemultiplexverfahren (CDMA)
- WP: Spreizcode
- WP: Time Division Multiple Access (TDMA)
- WP: Laufzeitmessung
- WP: Galileo
- WP: Atomuhr
- WP: Frequenzband
- WP: Erdatmosphäre
- WP: Troposphäre
- WP Ionosphäre
- WP: Almanach
- WP: Assisted Global Positioning System (A-GPS)
- WP: Differential Global Positioning System (D-GPS)
- WP: Referenzstation
- WP: Fundamentalstation
- WP: Sonnenaktivität
- WP: Ground Based Augmentation System
- WP: Satellite Based Augmentation System
- WP: European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)
- WP: Polarlicht
- WP: GLONASS
- WP: Beidou (ehem. Compass)
- WP: Standortbezogene Dienste
- WP: Plattentektonik
- WP: Frequenzmultiplexverfahren (FDMA)
- WP: Phasenverschiebung
- ESA: Galileo Services
Shownotes
RZ007 Weltraumschrott
Die Überreste bisheriger Missionen gefährden in zunehmendem Maße die Zukunft der Raumfahrt
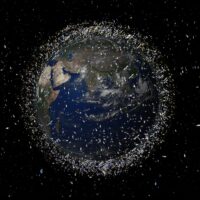
Dauer:
1 Stunde
26 Minuten
Aufnahme:
26.10.2010

Holger Krag Space Debris Office, ESA |
Themen: Die Entdeckung des Problems und das Kesslersyndrom; Spätzünder im Orbit; Trümmer erzeugen Trümmer; Kollisionen von Raumfahrzeugen; Weltraummüll in Erdbeobachtungs- und gesynchronen Orbits; Messgeräte für Weltraumverschmutzung; Kataloge und Simulationssoftware; Kollisionsvermeidung; Aufbau eines europäischen Weltraum-Überwachungssystems; Weltraumwetter; wie es zur Kollision zweiter Satelliten kam; Weltraumrecht; Vermeidungsstrategien; Entfernen von Raketenstufen und Nutzlasten aus dem Orbit nach Missionsende; Friedhöfe und Parkplatzreservierung im geostationären Orbit; Deaktivierung eines Satelliten; Klondike im Orbit; Tankablesung im All; Verglühen von Material in der Erdatmosphäre; manuelles Entfernen von Schrott im All; Pfandflaschensysteme im Orbit; Abschiessen von Objekten durch Laser; Nachtanken von Satelliten; Ausbildung.
Links:
- ESA: Büro für Weltraumrückstände
- WP: Weltraummüll
- WP: Astrophysik
- WP: Astronomie
- TU Braunschweig: Master-Studiengang Luft- und Raumfahrt
- WP: Kessler-Syndrom
- WP: Weltraumüberwachungsnetzwerk der USA
- WP: Geosynchroner Satellit
- WP: Hypergol
- WP: Satellitenkollision am 10. Februar 2009
- WP: Iridium
- ESA: Internationale Raumstation ISS
- WP: Internationale Raumstation ISS
- WP: Gravitation
- WP: Spanische Wand
- WP: Aerogel
- ESA: Hubble-Weltraumteleskop
- WP: Hubble-Weltraumteleskop
- WP: NORAD Weltraumschrottkatalog
- ESA: Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference (MASTER)
- WP: Tin foil hat
- ESA: Space Situation Awareness (SSA)
- WP: Asteroid
- ESA: Spezial: Special: Near Earth Objects – Eine Gefahr aus dem All?
- WP: Sonnenwind
- WP: Erdmagnetfeld
- ESA: ESA Ministerrat
- WP: Internationale Fernmeldeunion (ITU)
- WP: Delta Velocity
- WP: Klondike-Goldrausch
- WP: Pazifischer Ozean
- ESA: Automated Transfer Vehicle (ATV)
- WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
- WP: Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums
- DLR: Deos
- WP: Internationale Raumstation
Shownotes
RZ006 Erdbeobachtung
Der Blick aus dem All ist die Basis der modernen Erforschung und Nutzung der Erde

Dauer:
1 Stunde
48 Minuten
Aufnahme:
22.10.2010
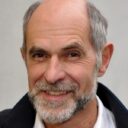
Hans-Joachim Lotz-Iwen Earth Observation Center, DLR |
Themen: DLR-Institute zur Erdbeobachtung; Tag der offenen Tür; die Bedeutung von Wiederholraten; Erdbeobachtung durch Flugzeuge; Beginn der Erdbeobachtung; das erste Fot oder ganzen Erde; die Erdatmosphäre; Wettersatelliten; Beobachtung der Erde aus großen Enterfernungen, Bedürfnisse und Anforderungen verschiedener Auswertungsarten; Abtastung der Erdoberfläche mit Radar und spezifische Absorbtion und Reflektion unterschiedlicher Materialien und Vegetation; Verwendung von Infrarotstrahlung; warum der Wald immer rot ist; der spektrale Fingerabdruck; Ground Truth; wie man in die Meere schaut; Nutzung der Erdbeobachtung für Archäologie und die Suche nach Atlantis; Messung des Erdschwerefelds mit Discokugeln; Beobachtung urbaner Regionen; Stadtklimaplanung und Grünanlagenkartierung; Einsatz im Agrarbereich; Katastrophenhilfe und zivile Sicherheit; Koordinierter Einsatz im Katastrophenfall; Hilfe bei Waldbränden; Eigenschaften der Sonnenstrahlung; Zentrum für satellitenbasierte Kriseninformation; Krisenunterstützung bei Tsunamis; Datenübermittlung zwischen Satelliten und Basisstationen; Landsat und Bildatlas; Kosten der Kartographierung der Erde; ; Landkartierung für Verkehrsplanung; ; Erstellung digitaler Höhenmodelle; Shuttle Radar Topography Mission; TerraSAR-X und TanDEM-X; Radarinterferometrie; der Trend zu kleinen Satelliten und Satellitenschwärme; CryoSat und die Erforschung der Poleisdecke; ; Satellitenerkundung im militärischen Bereich; Keyhole-Satelliten; ; Vor- und Nachteile drohnenbasierter Erdbeobachtung; Windmessung aus dem All; Fernerkundungs-Ausbildung durch Geowissenschaften und Geoinformatik; ; Datenauswertung und Langzeitarchivierung von Rohdaten; Data Mining; Bedeutung der Erdbeobachtung.
Links:
- DLR: Oberpfaffenhofen
- DLR: Institut Earth Observation Center
- DLR: Tag der offenen Tür
- WP: Erdbeobachtung
- DLR: Erdbeobachtung
- WP: Blue Marble
- WP: Erdatmosphäre
- WP: Meteosat
- WP: Geosynchrone Umlaufbahn
- WP: Radar
- WP: Mikrowellen
- WP: Infrarotstrahlung
- WP: Ground Truth
- WP: Atlantis
- WP: Erdschwerefeld
- International Charter Space & Major Desasters
- DLR: Zentrum für satellitenbasierte Kriseninformation (ZKI)
- Youtube: Tsunami-Warnsystem
- WP: Landsat
- WP: MODIS
- Wolfram Alpha: Kosten der Kartographierung der Erde
- WP: Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
- WP: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
- DLR: SRTM-Tagebuch von Astronaut Gerhard Thiele
- WP: Space Transportation System STS-99
- DLR: TerraSAR-X
- WP: TerraSAR-X
- DLR: TanDEM-X
- WP: TanDEM-X
- DLR: Webcast: TanDEM-X – Erdbeobachtung in 3D
- WP: Radarinterferometrie
- ESA: CryoSat
- WP: CryoSat
- WP: Keyhole
- WP: Geowissenschaften
- WP: Geoinformatik
Shownotes
RZ005 Planetenforschung
Ein Blick auf unsere Nachbarn im Sonnensystem und ihrer Erforschung

Dauer:
2 Stunden
12 Minuten
Aufnahme:
07.12.2010

Ulrich Köhler Institut für Planetenforschung, DLR |
Themen: DLR-Standort Adlershof und der Wissenschaftsstandort Berlin; Goldsuche im Urwald; Entstehung von Sonnen; Gasplaneten als gescheiterte Sonnen; Steinplaneten und Monde; Verteilung der Materie im Sonnensystem; Missionen zum Jupiter und Saturn; Zusammensetzung von Planeten; Zwergplaneten und die freigeräumten Planetenbahnen; Planetenrotation und warum der Uranus rollt und nicht kreist; warum der Mond immer nur eine Seite zeigt; wie ein Planet entsteht; Planetenerhitzung und wie der Treibhauseffekt die Erde wohltemperiert; Eis in Kältefallen auf Merkur und Mond; Voraussetzungen für die Entstehung von Leben; die Forschung nach extraterrestrischem Leben; Wasser und die Wahrscheinlichkeit von Leben auf dem Mars; Ursachen der Wasserkanäle auf dem Mars; woraus die Planetenforschung ihre Erkenntnisse gewinnt; Wasserkrusten und -ozeane auf den Eismonden der Gasplaneten; Kommende Raumfahrtmissionen zur Planetenerkundung; die Entdeckung von Exoplaneten und die Wahrscheinlichkeit von erdähnlichen Planeten in anderen Sternensystemen; aktuelle und zukünftige Mondforschung; der Mond als „Sprungbrett“ für aufwändige Fernmissionen;
Links:
- DLR: Institut für Planetenforschung
- DLR: DLR-Standort Berlin-Adlershof
- WP: Technische Universität Berlin
- WP: Freie Universität Berlin
- WP: Flughafen Berlin Brandenburg
- WP: Humboldt-Universität zu Berlin
- WP: Apollo 11
- WP: Geologie
- WP: Multispektral
- WP: Spektrometer
- WP: Geophysik
- WP: Extrasolarer Planet
- WP: Astrogeologie
- DLR: Standort Oberpfaffenhofen
- WP: Akademie der Wissenschaften der DDR
- WP: Geodäsie
- WP: Terahertzstrahlung
- WP: Planet
- WP: Galileo Galilei
- WP: 51 Pegasi b
- WP: Sonne
- WP: Wasserstoff
- WP: Helium
- WP: Immanuel Kant
- WP: Pierre-Simon Laplace
- WP: Kant-Laplace-Theorie
- WP: Kernfusion
- WP: Äquivalenz von Masse und Energie
- WP: Doppelstern
- WP: Jupiter
- WP: Saturn
- WP: Satellit (Astronomie)
- WP: Uranus
- DLR: Warum tanzen manche Planeten aus der Reihe?
- WP: Neptun
- WP: Van-der-Waals-Kräfte
- WP: Brauner Zwerg
- WP: Eisen
- WP: Merkur
- WP: Tabula rasa
- WP: Mars
- WP: Asteroid
- WP: Asteroidengürtel
- WP: Ceres
- WP: Zwergplanet
- WP: Chicxulub-Krater
- WP: Kuipergürtel
- WP: Oortsche Wolke
- WP: Sonnenwind
- WP: Komet
- WP: Interstellare Materie
- WP: Mond
- DLR: Wie entstand der Mond?
- WP: Asterix
- WP: Gasplanet
- WP: Erdähnlicher Planet
- WP: Galileo
- WP: Cassini-Huygens
- DLR: Cassini-Huygens
- WP: Geysir
- WP: Liste der Saturnmonde
- WP: Titan
- WP: Atmosphäre
- WP: Elektronengas
- WP: Plasma
- WP: Pluto
- DLR: Warum ist Pluto kein Planet mehr?
- WP: Triton
- WP: Sublimation
- RZ002 Missionsplanung
- WP: Rosetta
- WP: Ekliptik
- WP: Geoid
- WP: Lava
- WP: Magma
- WP: Gezeitenkraft
- WP: Gebundene Rotation
- WP: Akkretion
- WP: Protoplanet
- WP: Radioaktivität
- WP: Magmatische Differentiation
- WP: Differenzierung
- WP: Venus
- WP: Plattentektonik
- WP: Wasser
- WP: Exosphäre
- WP: Rotationsachse
- WP: Arecibo-Observatorium
- WP: Kältefalle
- WP: Leben
- DLR: Helmholtz Allianz ‚Planetenentwicklung und Leben‘
- WP: Erdmagnetfeld
- DLR: Habitable Zone
- WP: Habitable Zone
- WP: Exobiologie
- WP: Kohlendioxid
- WP: Organische Chemie
- WP: Biomolekül
- WP: Arsen
- WP: Silicium
- WP: Vulkanismus
- WP: Ganymed
- WP: Europa
- WP: Europa Jupiter System Mission
- WP: Dopplereffekt
- DLR: CoRoT
- WP: CoRoT
- ESA: Plato
- WP: Berge des ewigen Lichts
- WP: Lunar Reconnaissance Orbiter
- DLR: Venus Express
- WP: Venus Express
- DLR: Mars Express
- WP: Mars Express
- DLR: Rosetta
- WP: Rosetta
- WP: Dawn
- WP: Vesta
- WP: MESSENGER
Shownotes
RZ004 Operations
Steuerung und Betrieb von Raumfahrt-Missionen im Orbit und im Deep Space
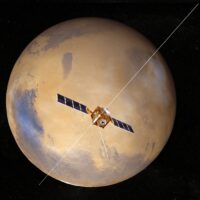
Dauer:
1 Stunde
46 Minuten
Aufnahme:
27.10.2010

Michel Denis Spacecraft Operations Manager, ESOC, ESA |
Themenüberblick: Ground Segment; Bodenstationen und Überwachungsnetzwerke; internationale Kooperation beim Überwachen von Missionen; das Kontrollzentrum; Simulation der Startphase; Übernahme der Satelliten nach dem Start durch das Team; Kontakt mit dem Satelliten über die Bodenstationen; Rosetta und Mars Express als erste interplanetare Missionen der ESA; Navigation Weltraum durch Beobachtung der Sterne; Verkehrsregeln im Weltall; die Anflugphase von Mars Express; Aufgaben der Kontrollräume; Erforschung der Marsoberfläche und Marsmonde; Erdbeobachtungsmissionen; Bewältigung der Datenmengen; Einfluss der Sonne auf interplanetarische Missionen; Teamarbeit.
Links:
- ESA: ESOC
- ESA: Spacecraft Operations
- WP: ESOC
- WP: Meteosat
- EUMETSAT: Meteosat
- École Centrale Paris
- ESA: ESTRACK
- WP: Deep Space Network
- WP: Canberra Deep Space Communication Complex
- WP: Madrid Deep Space Communications Complex
- WP: Goldstone Deep Space Communications Complex
- ESA: Marlargüe, Argentinien
- ESA: Special: Mars Express
- ESA: Mars Exrpress
- WP: Mars Express
- ESA: Cluster
- WP: Cluster
- ESA: Spezial: Herschel & Planck
- ESA: Herschel
- WP: Herschel-Weltraumteleskop
- ESA: Planck
- WP: Planck-Weltraumteleskop
- WP: Impulserhaltungssatz
- ESA: Hubble-Weltraumteleskop
- WP: Hubble-Weltraumteleskop
- WP: Planck-Weltraumteleskop
- WP: XMM-Newton
- ESA: Integral
- WP: Astrometrie
- ESA: Gaia
- WP: Gaia
- ESA: CryoSat
- WP: CryoSat
- WP: Sextant
- ESA: Soyus
- WP: Sojus
- ESA: Beagle 2
- WP: Beagle 2
- WP: Astronomische Einheit
- WP: Mars Exploration Rover
- WP: Spektrometer
- WP: Radar
- WP: Ionospähre
- WP: Radioaktivität
- ESA: Materials Science Laboratory (MSL)
- WP: Materials Science Laboratory (MSL)
- WP: Mars Reconnaissance Orbiter
- WP: Phobos
- WP: Deimos
- WP: Todesstern
- ESA: Rosetta triumphs at asteroid Lutetia
- WP: Lutetia
- ESA: Special: Venus Express
- WP: Venus Express
- WP: ESRI
- ESA: New Norica – DSA 1:
- ESA: Cebreros – DSA 2:
- ESA: Malargüe – DSA 3
- WP: Koronaler Massenauswurf
- WP: Sonnenwind
- WP: Frequenzband
- ESA: BepiColombo
- WP: BepiColombo
- WP: Konjunktion
Shownotes
RZ003 Raketenantriebe
Was Raumfahrzeuge in den Orbit bringt und wie Triebwerke gebaut und getestet werden

Ralf Hupertz, Ingenieur beim Institut für Raumfahrtantriebe des DLR in Lampoldshausen führt in die Prinzipien und Details der Raketenantriebe ein, bietet Einblick in die Geschichte und Zukunft der Technologie und erläutert die Bedeutung dieses Technikfelds für die gesamte Raumfahrt.
Dauer:
2 Stunden
2 Minuten
Aufnahme:
25.10.2010

Ralf Hupertz Institut für Raumfahrtantriebe, DLR |
Themenüberblick: Ausbildung; erste Raketen; Raketentreibstoffe; Schubentwicklung und Triebwerksdüsen; die Notwendigkeit von Mehrstufenraketen; selbstzündende Treibstoffe; Entwicklung der Antriebskonzepte über die Zeit; Feststoffraketen; der Countdown; Betankung der Rakete; Zündung der Treibwerke; der Raketenstart; Neue Triebwerke; neue Raketen in Kourou: Vega und Sojus; die Einstellung des Space Shuttle zukünftige Raumfahrtprogramm der NASA; Rettungssysteme und Rettungskapseln; Antriebe für Satelliten.
Links:
- DLR: DLR Lampoldshausen
- DLR: Institut für Raumfahrtantriebe
- WP: Institut für Raumfahrtantriebe
- RWTH Aachen Fakultät für Maschinenwesen
- WP: Was ist Was
- WP: Space Shuttle
- WP: Apollo
- WP: Schub
- WP: Oxidationsmittel
- WP: Sänger
- WP: Eugen Sänger
- DLR: Zur Geschichte der Raumfahrt
- DLR: Geschichte des Standorts Lampoldshausen
- WP: Orbiter
- WP: North American X-15
- WP: Umlaufbahn
- WP: SpaceShipTwo
- WP: A4
- WP: Aggregat 9 (A9)
- WP: Flüssigsauerstoff
- WP: Wasserstoff
- WP: Ethanol
- WP: Wernher von Braun
- WP: Raketentreibstoff
- WP: Brennkammer
- WP: Lavaldüse
- WP: Raketentriebwerk
- WP: Schallgeschwindigkeit
- WP: Mach-Zahl
- WP: Impuls
- WP: Strömungslehre
- WP: Saturn-Rakete
- WP: Stufenrakete
- WP: Spezifischer Impuls
- WP: Stufenrakete
- WP: Internationales Geophysikalisches Jahr
- WP: Sputnik
- WP: Ariane
- DLR: Geschichte der Ariane-Rakete
- DLR: Video zu 30 Jahre Ariane
- WP: Ariane 1
- WP: Hydrazin
- WP: Distickstofftetroxid
- WP: Feststoffraketentriebwerk
- WP: Ariane 4
- WP: Vulcain
- DLR: Prüfstände des DLR in Lampoldshausen
- WP: Centre Spatial Guyanais
- WP: Wunderkerze
- WP: Countdown
- WP: Kelvin
- WP: Helium
- WP: Fritz Lang
- WP: Frau im Mond
- WP: Vinci
- WP: Erdatmosphäre
- WP: Dichte
- WP: Überschallflug
- WP: Staudruck
- WP: Aestus
- WP: Ariane 5 ECA
- WP: Geosynchrone Umlaufbahn
- WP: Weltraummüll
- WP: Automated Transfer Vehicle
- WP: HM-7
- WP: Viking
- WP: Snecma
- WP: EADS Astrium
- WP: Volvo Aero
- WP: Avio
- WP: Nenngröße H0
- WP: Vega
- WP: Sojus
- WP: Baikonur
- WP: Juri Alexejewitsch Gagarin
- WP: Columbia
- WP: Constellation
- WP: Challenger
- WP: Boeing
- WP: Delta
- WP: Lockheed Martin
- WP: Atlas V
- WP: Apogäumsmotor
- WP: Cassini-Huygens
- WP: Galileo
Shownotes
RZ002 Missionsplanung
Die Planung von Raumflügen ist eine komplexe Sache und wird Jahre im Voraus in Angriff genommen

Missionsanalyst Markus Landgraf vom European Space Operations Center (ESOC) der ESA in Darmstadt berichtet in dieser Ausgabe ausführlich wie neue Missionen geboren werden und wie man sie konkret plant, wie man die Koordinierung mit beteiligten Gruppen durchführt und in welchem Maße die Planung letztlich auch die tatsächliche Durchführung der Mission beinflusst. Ein spannender Einblick in aktive Raumfahrt bis zu dem Moment wo der Countdown beginnt.
Dauer:
1 Stunde
50 Minuten
Aufnahme:
26.10.2010

Markus Landgraf Missionsanalyst, ESOC, ESA |
Links
- WP: European Space Operations Center (ESOC)
- ESA: European Space Operations Centre (ESOC)
- Youtube: Hinter den Kulissen des Europäischen Satellitenkontrollzentrums ESOC
- WP: European Space Research and Technology Centre (ESTEC)
- ESA: European Space Research and Technology Centre (ESTEC)
- ESA: Virtual Tour of the ESA Test Centre (Flash)
- WP: European Space Astronomy Centre (ESAC)
- ESA: European Space Astronomy Centre (ESAC)
- ESA: CryoSat Auf eisiger Mission
(Special) - ESA: ESA Science Program Committee (SPC)
- WP: Rosetta
- ESA: Rosetta – der Kometenjäger (Special)
- DLR: Animation des Rosetta-Flugs
- WP: Giotto
- ESA: ESA Science & Technology
- WP: Halleyscher Komet
- WP: Komet 46P/Wirtanen
- WP: Komet Tschurjumow-Gerasimenko
- WP: EADS Astrium
- WP: Arianespace
- WP: Snecma
- WP: Swing-By
- WP: Astronomische Einheit
- WP: Komet Hale-Bopp
- WP: Oortsche Wolke
- WP: Mars Express
- ESA: Mars Express – Auf der Suche nach Leben (Special)
- WP: Ariane 5
- ESA: Die Ariane 5: der Standardträger
- WP: Apsis
- WP: Geysir
- WP: Hydrazin
- WP: Sonnenwind
- WP: European Cooperation for Space Standardization
- WP: Gaia
- ESA: ESA Space Science: Gaia
- WP: Venus Express
- ESA: Venus Express – Per Express zur Göttin der Liebe
- WP: Mars 96
- WP: SMART-1
- ESA: SMART-1
- WP: Ionenantrieb
- WP: Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS)
- WP: Hubble-Weltraumteleskop
- ESA: Spacetelescope.org
- WP: Hipparcos
- ESA: The Hipparcos Space Astrometry Mission
- WP: Apogäumsmotor
- ESA: ESA Cosmic Vision
- WP: Titan
Shownotes
RZ001 Raumfahrt in Deutschland und Europa
Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des DLR und ESA-Ratsmitglied Jan Wörner

Dauer:
1 Stunde
31 Minuten
Aufnahme:
20.08.2010

Jan Wörner Vorstandsvorsitzender, DLR |
- DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
- ESA: European Space Agency
- WP: Jan Wörner
- DLR: Jan Wörners Blog
- Right Stuff, Wrong Sex: NASA’s Lost Female Astronauts
- DLR: DLR-Forschungsbereiche
- WP: Raumfahrtorganisationen
- US-Raumfahrtbehörde NASA
- Japanische Raumfahrtagentur JAXA
- WP: DLR
- WP: ESA
- ESA: ESA-Standorte
- WP: Europäischer Weltraumbahnhof Kourou
- WP: Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla 2010
- DLR: Sonderseite Vulkanasche-Wolke
- DLR: Satelliten-Kartierung zur Katastrophenhilfe-Unterstützung in Haiti
- DLR: Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformation (ZKI)
- YouTube: Tsunami-Warnsystem
- WP: Ariane 5
- WP: Bemannte Raumfahrt
- ESA: Columbus-Forschungslabor
- WP: Internationale Raumstation ISS
- WP: Außenbordeinsätze
- DLR: Automated Transver Vehicle (ATV)
- ESA: DLR: Automated Transver Vehicle (ATV)
- WP: Automated Transfer Vehicle
- WP: Constellation-Programm
- WP: Jacques Piccard
- WP: Where no man has gone before
- ESA: Mars500
- ESA: Mars Express
- DLR: HRSC auf Mars Express
- ESA: Venus Express
- DLR: Erdbeobachtung
- WP: TerraSAR
- DLR: TanDEM-X-Missionsblog
- ESA: GOCE
- WP: Pioneer 10
- WP: Pioneer 11
- WP: Plaketten an Bord der Pioneer-Raumsonden
- ESA: Cryosat
- ESA: Galileo-Satellitennavigationssystem
- DLR: Jobs & Karriere beim DLR
- ESA: Careers at ESA
- DLR: DLR_next für Jugendliche
- DLR: DLR-Schülerlabore
- DLR: DLR-Simulations- und Softwaretechnik
- DLR: Praktika beim DLR
- YouTube: Traumjob in Luft- und Raumfahrt
Shownotes
RZ000 Einführung
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.


